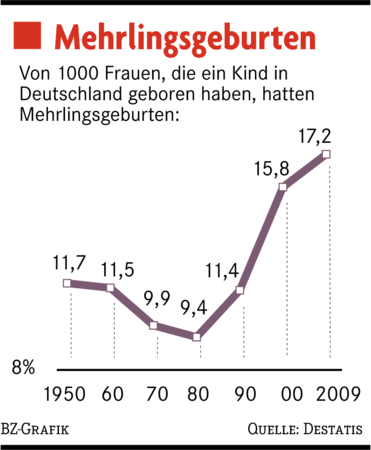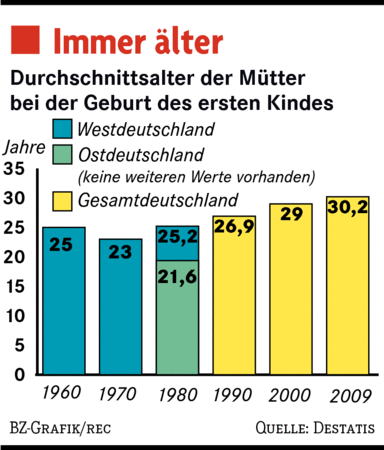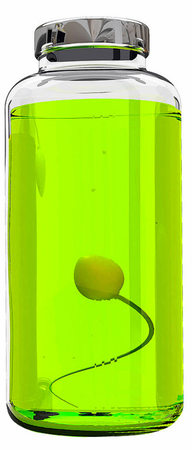LA BOTELLA auch in WIKIPEDIA !!!
https://de.wikipedia.org/wiki/La_BotellaLesen Sie doch mal, wie La Botella Anwender ihre Probleme gelöst haben.
Erfolgreiche La Botella Anwender
Sie möchten IHR Baby, und das möglichst bald?
Nichts was Sie versuchten hat funktioniert?
http://kinderwunsch-schwanger-mit-la-botella.blogspot.com/
Wenn Regelschmerzen den Alltag belasten
"Bei 40 bis 60 Prozent der Frauen mit starken Regelschmerzen steckt wahrscheinlich eine Endometriose dahinter", weiß Alexandra Borchard-Becker, Fachreferentin der VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. Die ständig wiederkehrenden, zum Teil auch dauerhaft bestehenden Schmerzen und weitere Beschwerden sind für die betroffenen Frauen außerordentlich belastend. Die Lebensqualität, der berufliche und familiäre Alltag sowie Freizeitaktivitäten sind stark eingeschränkt. Helfen rezeptfrei erhältliche Schmerzmittel, z. B. Ibuprofen nicht mehr, kann das ein weiteres Zeichen für eine Endometriose sein, ebenso wie ein unerfüllter Kinderwunsch. Häufig vergehen mehrere Jahre, bis die Erkrankung festgestellt wird. Nicht selten wird erst nach drei bis sieben, manchmal sogar erst nach zehn Jahren diese Diagnose gestellt. Die Behandlung ist darauf ausgerichtet, die starken Beschwerden zu lindern. Eine ursächliche Therapie und eine Heilung sind bisher nicht möglich.
"Frauen, die unter einer sehr schmerzhaften Regelblutung leiden, sollten daher mit ihrem behandelnden Gynäkologen das Thema Endometriose ansprechen und diagnostisch abklären lassen", empfiehlt die Fachreferentin. Die chronische Erkrankung ist gekennzeichnet durch gutartige Wucherungen von Gebärmutter-Schleimhaut, die sich in der Bauchhöhle ansiedeln. Sie unterliegen dem Menstruationszyklus, das Blut kann aber nicht abfließen. Daher sammelt es sich im Bauchraum an und kann dort mit dem Gewebe oder Organen verkleben oder verwachsen. Entzündungen und Zysten können entstehen. Die Folge sind mehr oder weniger starke, krampfartige Schmerzen, ein Teil der Frauen hat auch keine Beschwerden. Die Ursachen der Erkrankung sind bisher noch weit gehend unklar.
Die 24-seitige Broschüre enthält ausführliche Informationen über Regelbeschwerden sowie Tipps zur unterstützenden Selbstbehandlung. Weitere Themen sind den Wechseljahren und den umstrittenen Hormontherapien sowie dem Brustkrebs gewidmet. Das Heft kann für 4,00 Euro (inkl. Versand) bei der VERBRAUCHER INITIATIVE unter www.verbraucher.combestellt bzw. für 2,50 Euro heruntergeladenwerden.
Starke Monatsblutung – was tun?
Wenn die Regel sehr intensiv ist oder lange dauert, können organische Ursachen dahinterstecken, zum Beispiel ein Mangel des Gelbkörperhormons Progesteron

Häufige Ursache: zu wenig Progesteron

Verhütungsmittel oder Hormonspirale kann helfen
Weitere Ursachen: Myome oder Polypen
Sex nach Terminplan bei unerfülltem Kinderwunsch
Statistisch gesehen verspricht die Drei-Tage-Regel erfolgt beim KinderwunschHaben Paare mit Kinderwunsch mindestens alle drei Tage Sex, besteht laut Aussage des Experten eine hohe Wahrscheinlichkeit einen fruchtbaren Tag der Frau zu erwischen. Wie Dr. Christian Albring erläuterte, ist die Eizelle nach dem Eisprung etwa 24 Stunden lang befruchtungsfähig, der männliche Samen überlebe seinerseits im Körper der Frau mindestens 48 Stunden. Rein statistisch müsste die Drei-Tage-Regel demnach ausreichen, um eine natürliche Befruchtung, das heißt ein Zusammentreffen der Eizelle und Samen zu erreichen, so der Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte in München. Allerdings lässt sich die Drei-Tage-Regel nicht bei allen Paaren einhalten, auch ist sie vielen zu ungenau und einigen zu anstrengend. Hier kann eine genauere zeitliche Bestimmung des Eisprungs helfen.
Zeitpunkt des Eisprungs feststellenLaut Aussage des Experten lässt sich der Zeitpunkt des Eisprungs einer Frau feststellen, indem regelmäßig ihre Körpertemperatur gemessen wird, da während des Eisprungs die Temperatur um rund ein halbes Grad ansteigt. Allein der Temperaturanstieg ist jedoch kein verlässliches Signal, da auch Einflussgrößen wie beispielsweise Fieber im Zuge von Infektionen oder anderen Erkrankungen, körperliche Anstrengung, Schlafmangel und übermäßiger Alkoholkonsum eine leicht erhöhte Körpertemperatur bedingen können. Durch die kontinuierliche Beobachtung des eigenen Zyklus entwickeln die Frauen allerdings ein besseres Gespür dafür, wann der Eisprung tatsächlich erfolgt. Weitere Unterstützung kann ein Facharzt beziehungsweise Gynäkologe bieten, der auf Basis einer Ultraschall-Untersuchung ermittelt, wie weit die Eizelle in der ersten Zyklushälfte gereift ist, erläuterte Dr. Albring. Die anschließende Beobachtung ermöglicht eine relativ exakte Bestimmung des Eisprung-Zeitpunkts. Dieser erfolgt in der Regel ungefähr in der Mitte des weiblichen Zyklus und ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Befruchtung. Liegt der Eisprung allerdings schon einige Tage zurück, steht die Frau kurz vor ihrer nächsten Periode und eine Schwangerschaft ist nahezu ausgeschlossen.
Gesunder Lebensstil erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen BefruchtungNeben den zeitlichen Rahmenbedingungen spielen laut Aussage des Berufsverbandes der Frauenärzte bei einer erfolgreichen Befruchtung auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle. So hätten zum Beispiel zahlreiche Studien bewiesen, „dass der Eintritt einer gewünschten Schwangerschaft vom Gesundheitszustand und dem Ernährungsverhalten abhängig ist und durch manche Änderungen des gewohnten Lebensstils beider Partner bereits vor Beginn der Schwangerschaft positiv beeinflusst wird“, berichtet der BVF auf seiner Internetseite. Mit anderen Worten: Paare mit unerfülltem Kinderwunsch sollten zunächst den eigenen Lebensstil gesünder gestalten. Maßgeblich ist hierbei laut Aussage der Experten die Ernährung. Neben einem Verzicht auf ungesunde Lebensmittel beziehungsweise einer Umstellung auf gesunde Nahrung wie Obst, Gemüse, Vollkorn- und Milchprodukte sollten die Betroffen auch darauf achten, ausreichend Mikronährstoffe wie Folsäure, Jod und Eisen aufzunehmen. Bestehendes Übergewicht ist möglichst abzubauen. Raucher sollten ihren Tabakkonsum einstellen, da Nikotin die empfängnisbereite Eizelle schädigt und eine Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutterschleimhaut erschweren kann. Bei weiterreichendem Beratungsbedarf können sich Paare mit unerfülltem Kinderwunsch an die Ärzte im Berufsverband der Frauenärzte wenden. (fp)
Myome
behindern
Fruchtbarkeit

Oft stecken Veränderungen der
Gebärmutter hinter einem unerfüllten
Kinderwunsch – Experten können helfen.
Sabine und Bernd sind seit Jahren ein Paar. Die 33-jährige Bibliothekarin und der 35-jährige Grafiker kennen sich schon seit ihrer Schulzeit, seit fünf Jahren wohnen sie in einer gemeinsamen Altbauwohnung. Dort wollen sie bleiben. „Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Kind“, sagten sie. Also beschlossen sie, es zu probieren. Doch auch nach einem halben Jahr wurde Sabine nicht schwanger. Auch nach einem Jahr passierte nichts.
„Wenn ein gesundes Paar auch nach einem Jahr intensiver Bemühungen kein Kind bekommt, kann das ein Zeichen dafür sein, dass etwas Wesentliches nicht stimmt“, sagt der Gynäkologe und Repoduktionsmediziner Professor Dr. Gerhard Leyendecker. Ist sichergestellt, dass der Mann zeugungsfähig ist und es keine anderen medizinischen Gründe für die Unfruchtbarkeit des Paares gibt, empfiehlt sich ein Blick auf die Gebärmutter der Frau. „Es gibt hauptsächlich drei Möglichkeiten von Veränderungen am oder im Uterus, der eine Schwangerschaft erschweren oder gänzlich verhindern kann“, erklärt Leyendecker. „Das sind eine Fehlbildung der Gebärmutter, die Bildung einer gutartigen Wucherung oder eine chronische Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut“, zählt der Experte auf. Erst, wenn der Befund vorliegt, kann versucht werden, die
Gebärmutter mit einer adäquaten Operation in die Lage zu versetzen, ein Kind auszutragen.
„Oft wissen Frauen gar nicht, dass sie seit ihrer eigenen Geburt eine vielleicht unvollständig ausgeformte oder anders veränderte Gebärmutter haben“, erklärt Leyendecker. „Solche Verformungen sind auch für Frauenärzte nicht immer gleich zu sehen, viele suchen allerdings auch nicht danach“, sagt der Experte. Dabei können Fehlbildungen des Uterus dafür sorgen, dass sich ein Ei erst gar nicht in der der Gebärmutter einnistet, dass es zu frühen Abgängen oder zu Komplikationen während der Schwangerschaft kommt. Sabine unterzog sich einer detaillierten Untersuchung ihres Uterus, die Ärzte fanden nichts Ungewöhnliches. Als Nächstes wurde sie gefragt, ob sie öfter Regelbeschwerden habe. Sabine hat ihre Regel seit ihrem 16. Lebensjahr, sie komme regelmäßig und verlaufe normal. Erst auf die Frage, ob sie dabei Schmerzen habe, wurde Sabine stutzig: „Ich dachte immer, Regelschmerzen seien völlig normal. Die meisten meiner Freundinnen leiden darunter.“ Hier mahnt der Experte zur Vorsicht. „Starke Schmerzen sind bei der Regel kein normaler Zustand", sagt
Leyendecker. Ein sehr schmerzhaftes Ziehen im Unterbauch oder ein vermehrter Druck auf die Harnblase können ein Zeichen für ein Myom oder eine Endometriose sein.
„Eine gutartige Wucherung an oder in der Gebärmutter ist mitunter schwer zu finden, manchmal reicht sogar eine Ultraschalluntersuchung nicht aus“, sagt der Reproduktionsexperte. Und selbst wenn ein oder mehrere Myome lokalisiert werden, trauen sich viele Gynäkologen nicht an eine Operation, die je nach Lage der Wucherung ein hohes Verletzungsrisiko darstellt. „Das haben viele Kollegen schlichtweg nicht gelernt“, so Leyendecker. Früher rieten Ärzte ihren Patienten, die gesamte Gebärmutter herauszunehmen. Ein Kind zu bekommen wäre damit für immer unmöglich. „Dabei kennen wir heute eine Reihe von Möglichkeiten, zu operieren. Wichtig ist hier eine genaue Lokalisation der Wucherungen. Notfalls mit einer MRT.“ Gleiches gilt für die Endometriose, eine Wucherung der Gebärmutterschleimhaut. Auch diese chronische Erkrankung verursacht der Frau starke Schmerzen und unter Umständen einen vermehrten Harndrang. Dabei wächst die Schleimhaut auch außerhalb der Gebärmutterhöhle in den Bauch- und Beckenraum oder befällt die Eierstöcke. Die Behandlung der Symptome besteht in einer Operation. „Bei einer Endometriose oder Adenomyose muss der Mediziner genau überlegen, ob minimal-invasiv operiert werden kann oder schlimmstenfalls ein Leibesschnitt vorgenommen werden muss“, erklärt Leyendecker. Viele Mediziner schrecken davor zurück, über eine minimal-invasive Operationsmethode hinauszugehen. Er rät daher jeder Frau, sich vor einem Eingriff bei einem Spezialisten genauestens zu informieren und beraten zu lassen. Einfache Untersuchungen werden sogar von der Krankenkasse übernommen.
Bei Sabine fanden die Experten tatsächlich ein großes Myom außerhalb der Gebärmutter in der Nähe der Wirbelsäule: „Die Ärzte sagten mir, das erkläre auch meine starken Regel- und Rückenschmerzen“. Gleichzeitig entfernten die Mediziner erste Anzeichen einer Endometriose. Beides hat sie gut überstanden, „und jetzt ist unser Kind unterwegs“, sagt Sabine und streichelt sich über den dicken Bauch.
Spermienanzahl - je höher, desto besser?!
Myome behindern Fruchtbarkeit

Oft stecken Veränderungen der Gebärmutter hinter einem unerfüllten Kinderwunsch – Experten können helfen.
Spermienanzahl - je höher, desto besser?!
Fakt ist jedoch, dass die Spermienanzahl der Männer in den vergangenen Jahrzehnten stark gesunken ist. Vor 50 Jahren, also bei unseren Vätern und Großvätern, lag die Spermienanzahl noch bei durchschnittlich 100 Millionen Samenzellen pro Milliliter Ejakulat. Heutzutage schwankt die Spermienanzahl der Männer zwischen 20 und 64 Millionen. Kaum zu glauben, wenn man(n) bedenkt, dass in einer Sekunde rund 1 000 Spermien in den Hodenkanälchen produziert werden - das macht ca. 3-4 Millionen pro Stunde(!).
Die Spermienanzahl ist neben der Spermienmobilität der ausschlaggebende Faktor der Fruchtbarkeit. Liegt die Spermienanzahl pro Milliliter Ejakulat unter 5 Millionen, gilt ein Mann als unfruchtbar. Bei einer Spermienanzahl zwischen 5 und 20 Millionen ist er zumindest wahrscheinlich unfruchtbar. Im Vergleich zum Abwärtstrend (siehe oben) könnte es bald dunkel aussehen. Gewissheit über die persönliche Spermienanzahl kann ein Spermiogramm geben, das Ergebnis einer Ejakulatsanalyse.
Völlig natürlich und kaum zu stoppen ist die sinkende Spermienanzahl mit fortschreitendem Alter. Aber auch hier Entwarnung: Mit der Quantität nimmt nicht automatisch die Qualität ab. Große Unterschiede gibt es auch je nach Region. Finnen, z. B. haben im Durchschnitt eine erheblich höhere Spermienanzahl als Engländer.
Unabhängig davon zeigen wir im Folgenden fünf Möglichkeiten auf, die Spermienanzahl positiv zu beeinflussen:
Je öfter man Geschlechtsverkehr hat, desto geringer ist die Spermienanzahl. Dies ist eine logisch nachvollziehbare Tatsache, da die Hodenkanälchen auch bei häufiger sexueller Aktivität nicht mehr als 100 % geben können. So ist bereits nach dreitägiger Abstinenz die Spermienanzahl deutlich erhöht. Jedoch ist dann die Spermienqualität niedriger, da mehr Spermienzellen geschädigt sind. Entscheidender für die Fruchtbarkeit ist die Qualität.
Sport ist nicht nur gesund und hält fit, sondern steigert vor allem auch die Produktion des Hormons Testosteron. Dieses ist unverzichtbar für die Produktion der Samenzellen. Das Gerücht, Fahrrad fahren würde die Spermienproduktion mindern, stimmt übrigens nicht! Solange man nicht an der Tour de France teilnimmt, wird die Spermienanzahl nicht darunter leiden. Empfohlen wird jedoch ein breiter Sattel und das Fahren im Stehen - so werden die Hoden noch besser durchblutet. Ein weiterer Tipp: Trainieren Sie gezielt Ihre Beckenbodenmuskulatur. Der Samenerguss kann so nicht nur besser kontrolliert, sondern die Erektionsfähigkeit sogar gesteigert werden!
Dass Alkohol und Nikotin als legale Drogen in Massen schädlich sein können, ist nichts Neues. Mal ein Glas Bier und eine Zigarette sind nicht bedenklich, jedoch sollte es dabei bleiben, wenn man die Spermienanzahl steigern möchte. Bewegung sowie Anzahl der Spermien werden durch erhöhten Konsum negativ beeinflusst. Zudem sinkt der Testosteronspiegel bei übermäßigem Alkoholkonsum. Dies kann zu Problemen bei der Ejakulation führen.
Ja, in der Tat, die Wahl der Unterhose hat nicht nur einen Einfluss auf Tragekomfort und den Eindruck auf Frauen, sondern auch auf die Spermienanzahl. Männer, die lockere Boxershorts haben eine höhere Spermienanzahl als jene, die sich für die engen, hodenquetschenden Slips entscheiden.
Sich abwechslungsreich und gesund zu ernähren, ist nicht nur entscheidend für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Nein, auch die Samenzellenproduktion und damit die Spermienanzahl kann positiv beeinflusst werden.
Ein Baby nicht um jeden Preis
Eine künstliche Befruchtung birgt das Risiko von Mehrlingen und Frühgeburten. Neue Leitlinien sollen in Österreich den Fokus auf gesunde Einlingsschwangerschaften legen.


 Es ist der 25. Juli 1978. Weltweit berichten Medien von der Geburt des britischen „Superbabes“ Louise Brown. Die Britin war vor fast 34 Jahren der erste Mensch, der künstlich im Reagenzglas (In-vitro) gezeugt wurde. Seither sind rund fünf Millionen Retortenbabys zur Welt gekommen, gab die Europäische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin am Wochenende auf ihrem Jahreskongress bekannt. Und die Zahl wird vermutlich rasant steigen.
Es ist der 25. Juli 1978. Weltweit berichten Medien von der Geburt des britischen „Superbabes“ Louise Brown. Die Britin war vor fast 34 Jahren der erste Mensch, der künstlich im Reagenzglas (In-vitro) gezeugt wurde. Seither sind rund fünf Millionen Retortenbabys zur Welt gekommen, gab die Europäische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin am Wochenende auf ihrem Jahreskongress bekannt. Und die Zahl wird vermutlich rasant steigen.
Belastung für die Psyche
Quälende Sehnsucht nach einem Kind
Wie wichtig die Erfüllung eines Kinderwunschs sein kann, verdeutlichte ein Team um Birgitte Baldur-Felskov vom Dänischen Krebsforschungszentrum auf derselben Tagung: Frauen, die ungewollt kinderlos bleiben, haben demnach ein stark erhöhtes Risiko für psychische Krankheiten.
Dass die unerfüllte Sehnsucht nach einem Baby das Wohlbefinden beeinträchtigt, gilt als Binsenweisheit. Doch die dänische Studie beeindruckt, weil es sich um eine landesweite Erhebung handelt, die zudem einen drastischen Einfluss der Kinderlosigkeit auf die psychische Gesundheit offenbart: Es wurden mehr als 98.000 Däninnen einbezogen, die zwischen 1973 und 2008 versucht hatten herauszufinden, weshalb sie nicht schwanger wurden. 54 Prozent der Frauen bekamen später doch ein Baby.
Bis Ende 2008 kamen fast 5000 Frauen wegen einer psychischen Störung ins Krankenhaus. Das Risiko für eine solche Einweisung war aber unter denjenigen, die kinderlos geblieben waren, um 18 Prozent erhöht. Diese Frauen entwickelten etwa eineinhalbmal so häufig eine Schizophrenie oder eine Essstörung wie die Mütter. Sie wurden doppelt so häufig drogen- oder alkoholabhängig. Depressionen traten aber nicht häufiger auf. Diese Auswirkungen sollten berücksichtigt werden, wenn Ärzte Frauen beraten, die über eine Kinderwunschbehandlung nachdenken, meint Baldur-Felskov.
Quelle: http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/psyche-quaelende-sehnsucht-nach-einem-kind-1.1399747
Späte Schwangerschaft 54-jährige Baronin erwartet Nachwuchs
Die Baronin spricht ehrfürchtig von einem Gottesgeschenk. Dabei seien die ersten vier Monate der Schwangerschaft furchtbar gewesen, gesteht Isabella von Schorlemer: „Da habe ich mich nur übergeben. Und dann war da natürlich die Angst, das Kind zu verlieren. Aber jetzt läuft´s prima.“
„Auf diesen Moment 15 Jahre lang hingearbeitet“
Zwei erwachsene Kinder hat die Baronin bereits, die 21 Jahre alte Charlotte und den 25 Jahre alten Mortimer. Trotzdem wünschte sie sich seit langem ein drittes Kind mit ihrem Lebensgefährten, dem 45 Jahre alten Gastronom Josef Laggner. Doch die Schwangerschaft strapazierte die Geduld der werdenden Eltern. „Auf diesen Moment haben wir 15 Jahre lang hingearbeitet. Endlich hat’s geklappt. Unser erstes gemeinsames Kind,“ freute sich Laggner.Erklären kann er sich das plötzliche Glück nur schwer: „Vielleicht lag es daran, dass ich vier Monate keinen Alkohol getrunken habe. Schwupps, war Isabella schwanger.“ Auf die Frage, ob das plötzliche Kinderglück nicht eher mit künstlicher Befruchtung zu tun hatte, reagiert Laggner ausweichend: „Auf jeden Fall mit ganz viel Liebe.“
Risiko einer Schwangerschaft im Alter
Dass Frauen in diesem Alter auf natürliche Weise schwanger werden ist jedenfalls äußerst selten. Ärzte schätzen das Risiko einer solchen Schwangerschaft als äußerst hoch ein. Genetische Erkrankungen können die Folge sein. Wohl der Hauptgrund dafür, dass das Geheimnis um die Schwangerschaft der Baronin von ihr ebenso gehütet wurde, wie das kleine Wesen, das in ihrem Bauch heranwächst....Kinderwunsch trotz Augenleiden und Diabetes
Schwangere sollten ihren Augenarzt auf ihren Zustand hinweisen, damit er bei Untersuchungen Mittel verwendet, die garantiert unschädlich für das Ungeborene sind. Die meisten Mittel gegen Augenleiden sind aber sowieso harmlos, wie Dr. Ohrloff erklärt: „Schwangere brauchen sich bei der augenärztlichen Kontrolle keine Sorgen zu machen, dass die zur Untersuchung eingesetzten Augentropfen ihrem Kind schaden.“ Insgesamt sollten Frauen mit Augenleiden ihren Kinderwunsch aber nicht aufschieben, da das Risiko für Augenleiden mit dem Alter steigt.
10 Mythen über Fruchtbarkeit und Schwangerschaft
 Mythos Schwangerschaft: Bekommen schlanke Frauen eher Mädchen? (Foto: Thinkstock)
Mythos Schwangerschaft: Bekommen schlanke Frauen eher Mädchen? (Foto: Thinkstock)
Dieser Irrtum kann ein für alle Mal ausgeräumt werden, denn das Gegenteil ist der Fall! Das beweist eine europaweite Studie, an der 60.000 Frauen teilgenommen haben. Ein Teil der Probandinnen setzte die Pille nach zwei Jahren ab, mit dem Ziel, schwanger zu werden. Nach einem Jahr waren fast 80 Prozent der Frauen schwanger. Bei Frauen, die keine Verhütungsmittel verwenden, ist die Empfängnisrate gleich hoch.
Dieses Gerücht kursiert hartnäckig. Wirklich bestätigt konnte es bisher nicht werden. Inzwischen haben sich zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen mit dem Zusammenhang zwischen männlicher Unfruchtbarkeit und dem Gebrauch von Handys oder Laptops beschäftigt. Das Ergebnis war nie eindeutig.
An diesem Mythos scheint etwas dran zu sein! Sehr schlanke, zierliche Frauen mit einem Gewicht von unter 54 Kilogramm bringen eher Mädchen zur Welt als Frauen, die über 54 Kilogramm wiegen. Dieses Ergebnis brachte eine italienische Studie zutage, bei der etwa 10.000 Geburten ausgewertet wurden.
Das kommt darauf an: Wenn es Ihnen darum geht, grundsätzlich schwanger zu werden, dann ist die Stellung beim Sex nicht entscheidend. Die Spermien finden ihren Weg! Wenn Sie aber versuchen wollen, das Geschlecht Ihres Babys zu beeinflussen, kann sich die Position durchaus auf das Geschlecht auswirken: Wollen Sie ein Mädchen zeugen, sollten Sie die Missionarsstellung wählen, möchten Sie einen Jungen, sollten Sie im „Doggy Style" Sex haben, so eine wissenschaftliche Empfehlung.
Viele Paare glauben, dass eine Frau eher schwanger wird, wenn sie nach dem Sex auf dem Rücken liegen bleibt, die Beine in die Luft streckt und vielleicht noch ein Kissen unter das Becken schiebt. Die Idee dahinter: Die Frau erleichtert den Spermien so den Weg zur Gebärmutter, indem sie die Schwerkraft verhindert.
Ein Paar, das alles ausprobiert hat, um schwanger zu werden, schließt endgültig mit diesem Thema ab, um dann wenige Wochen später, von einem positiven Schwangerschaftstest völlig überrascht zu werden. Das gibt es sicher immer wieder einmal. Die Regel ist das aber nicht!
Das stimmt tatsächlich! Schwangere Frauen sind generell oft etwas vergesslicher, unkonzentrierter und unaufmerksamer als vor der Schwangerschaft. Wie sehr sich die Vergesslichkeit auswirkt, hängt wiederum vom Geschlecht des Kindes ab, das sie erwarten:
Von wegen: Zwar können Männer im Gegensatz zu Frauen theoretisch tatsächlich weit über die 50 noch Kinder zeugen, aber wenn beispielsweise ein 70jähriger Mann noch einmal Vater wird, dann handelt es sich eher um einen „Glückstreffer".
Wer im Dauerstress ist, hat keine Reserven fürs Kinderkriegen. Das klingt einleuchtend und doch konnte diese Annahme wissenschaftlich nicht bestätigt werden. Wenn der Stress allerdings ungünstige Angewohnheiten mit sich bringt, wenn Sie beispielsweise vermehrt rauchen, Alkohol trinken oder sich nicht mehr bewegen, dann kann der Auslöser Stress zusammen mit seinen gesundheitsgefährdenden Begleiterscheinungen sehr wohl die Chancen auf eine Schwangerschaft reduzieren.
Sicherlich ist es von Vorteil, wenn Sie das Projekt „schwanger werden" unverkrampft angehen, mit Spaß bei der Sache sind und sich nicht (nur) von Ihrem Eisprungkalender diktieren lassen, wann Sie mit Ihrem Partner schlafen. Einen Orgasmus müssen Sie aber nicht unbedingt haben, um schwanger zu werden! Der Mann aber schon…! ;-)
Qualität des männlichen SamensRauchen und Alkohol schaden Spermien kaum – aber Slips
Qualität des männlichen Samens: Rauchen und Alkohol schaden Spermien kaum – aber Slips

Qualität des männlichen Samens: Rauchen und Alkohol schaden Spermien kaum – aber Slips -
Lange stand ein ungesunder Lebensstil des Vaters unter Verdacht, wenn derKinderwunsch unerfülltblieb. Eine Studie der Universities of Sheffield and Manchester widerlegt diese Annahme. Thema der Untersuchung: Beeinflussen bestimmte Lebenstilfaktoren die Beweglichkeit und Konzentration von Spermien?
Die Wissenschaftler befragten dazu 780 Männer. Alle wiesen nur wenige und relativ unbewegliche Spermien auf und waren wegen unerfüllten Kinderwunschs zur Behandlung in Fruchtbarkeitskliniken. Zur Kontrolle dienten knapp 1500 Männer, die bereits Kinder gezeugt hatten. Die Wissenschaftler unter der Leitung von Andrew Povey befragten alle Männer genau nach ihren Lebensgewohnheiten und ihrer Gesundheit. Der Fragekatalog befasste sich vor allem mit Faktoren wie Rauchen, Alkoholkonsum, Ernährung, Gewicht, Krankheiten, Beruf sowie Kleidungsgewohnheiten.
Weniger gefährlich als bisher angenommen
Das Ergebnis war verblüffend: Es ließ sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Rauchen und schlechter Spermienqualität feststellen. Die Spermien der Männer, die niemals geraucht hatten, waren nur geringfügig besser als die derjenigen, die täglich 20 Zigaretten konsumieren. Auch Alkoholkonsum und Übergewicht scheinen nur einen geringen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit des Mannes auszuüben. Studienleiter Andrew Povey fasst in einem BBC-Interview zusammen: „Diese Lifestyle-Faktoren beeinflussen zwar die Gesundheit allgemein, üben jedoch einen wesentlich geringeren negativen Einfluss auf die Spermienqualität aus als bisher angenommen.“Gelobte Boxershort
Als Männer mit besonders guter Samenqualität stellten sich übrigens solche heraus, die statt eng anliegender Slips bequeme Boxershorts trugen. Allan Pacey von der University of Sheffield legt Männern in diesem Zusammenhang ans Herz: „Wenn Sie ein Fan von engen Y-Fronten sind, sollten Sie wenigstens mal für ein paar Monaten zu einer lockereren Unterwäsche-Variante wechseln“.Zusammenfassend raten die Wissenschaftler Männern jedoch, trotz der Studienergebnisse möglichst gesund zu leben, auf das Gewicht zu achten, nicht zu fett zu essen, Rauchen und Alkohol trinken in vernünftigen Grenzen zu halten. Aber es gäbe keine Notwendigkeit, auf diese Dinge ganz zu verzichten, nur weil sie Vater werden wollen....
Quelle: http://www.focus.de/gesundheit/baby/news/qualitaet-des-maennlichen-samens-rauchen-und-alkohol-schaden-spermien-kaum-aber-slips_aid_767307.html
Kräutertees können eine Alternative zu Pharmazeutika sein.
Kräuter Tees zählen zusammen mit den Früchtetees zu den „teeähnliches Getränken“, das heißt, sie gleichen in der Zubereitungsweise konventionellen Tees, enthalten jedoch keine Teile der Teepflanze.

Medizin aus der Natur: Gegen viele Frauenleiden existieren Kräuter-Therapien als Alternative zu klassischen Medikamenten
HEILKRÄUTER UND IHRE WIRKUNG
*„Die neue Pflanzenheilkunde für Frauen“ von Prof. Dr. Ingrid Gerhard und Natascha von Ganski, Zabert-Sandmann-Verlag, 248 Seiten, 19,95 Euro. Ab Mittwoch im Handel
Quelle: http://www.bild.de/ratgeber/gesund-fit/kraeuter-und-pflanzenbehandlungen/die-besten-heilkraeuter-gegen-frauenleiden-22084048.bild.html
05.05.2012
Können Heilpflanzen Pillen ersetzen?
Enzym bestimmt Unfruchtbarkeit oder Fehlgeburt
Niedrige SGK1-Werte machen anfälliger für zellularen Stress
London (pte005/18.10.2011/10:00) - Wissenschaftler des Imperial College London http://imperial.ac.uk haben ein Protein identifiziert, das als eine Art von "Fruchtbarkeits-Schalter" arbeitet. Sind die Werte zu hoch, erhöht sich die Unfruchtbarkeit, sind sie zu niedrig, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt. Das Team um Jan Brosens vom Institute of Reproductive and Developmental Biology entnahm bei mehr als 100 Frauen Proben der Gebärmutterschleimhaut. Die Forscher schreiben in Nature Medicinehttp://nature.com , dass Frauen mit Unfruchtbarkeit über hohe Werte des Enzyms SGK1 verfügen, während diese nach einer Fehlgeburt niedrig waren.
Bauch: Unfruchtbarkeit von Frauen geklärt (Foto: pixelio.de, Templermeister)
19.10.2011
Fertilitäts-Schalter im Endometrium entdeckt
London – Ein Enzym in der Gebärmutterschleimhaut hat offenbar entscheidenden Einfluss auf den Erfolg einer Schwangerschaft. Laut einem Bericht in Nature Medicine (2011; doi: 10.1038/nm.2498) kann ein Mangel eine Fehlgeburt auslösen, während eine Überaktivität verhindert, dass es überhaupt zu einer Schwangerschaft kommt.
Das Team um Jan Brosens vom Imperial College London hatte die Uterusschleimhaut von 106 Frauen untersucht, deren Kinderwunsch unerfüllt blieb, entweder weil sie unfruchtbar waren oder weil es wiederholt zu Fehlgeburten gekommen war.
Bei der Untersuchung der Uterusschleimhaut stießen sie dann auf das Enzym SGK1 (Serin/Threonin-proteinkinase). Es reguliert den Ionentransport an der Zellmembran, der für die Zelle überlebenswichtig ist. Bei einem Mangel kommt es zum Zusammenbruch der Uterusschleimhaut, was eine Fehlgeburt zur Folge hat. Eine Überaktivität scheint dagegen zu verhindern, dass sich der Embryo in der Schleimhaut einnisten kann.
Beides könnte erklären, warum es bei Frauen mit verminderter SGK1-Aktivität zu Spontanaborten kommt. Weitere Experimente ergaben, dass der SGK1-Mangel die Anfälligkeit der Endometriumzellen gegenüber einem oxidativen Stress erhöht.
12.10.2011
Kinderwunsch unerfüllt obwohl körperlich alles O.K. ist?
Gehören auch Sie dazu oder kennen Sie jemanden?
Die medizinischen Ursachen wurden in den letzten Jahren genau erforscht.
Welche Rolle spielt aber die Psyche ungewollt kinderlos zu sein?
Wenn ein Paar kinderlos bleibt, sind die möglichen Ursachen bei Mann und Frau gleich verteilt. In 45 Prozent der Fälle sind die Ursachen beim Mann und ebenfalls in 45 Prozent bei der Frau zu finden. In nur 10 Prozent sind beide Partner unfruchtbar.
Die Gründe einer Unfruchtbarkeit sind vielfältiger Art. Oft verhindern körperliche Ursachen eine Schwangerschaft. Aber ebenso häufig spielen psychische Ursachen eine Rolle.
Inwieweit eine Fruchtbarkeitsstörung ausschließlich psychisch bedingt sein kann, ist nicht eindeutig zu klären.
“In der Praxis haben wir jedoch die Erfahrung gemacht, dass starker psychischer Stress, sowohl bei der Frau als auch beim Mann, zu deutlichen Störungen des Hormonhaushaltes führen”, merkt Olaf Souliotis vom aktipas® Institut in Liederbach bei Frankfurt an.
Stresshormone wie Kortison und Adrenalin bewirken, dass die Hypophyse nicht mehr ausreichend follikelstimulierendes Hormon produziert und blockieren so langfristig die Funktionen von Eierstöcken und Hoden. Ohne das FSH-Hormon unterbleibt die Botschaft an die Eierstöcke und Hoden, Follikel heranreifen zu lassen, beziehungsweise Spermien zu produzieren.
Ebenso haben alte und falsche Glaubenssätze, die nicht bearbeitet wurden, fatale Auswirkungen gezeigt, sodass es im ganzen Körpersystem zu Blockierungen durch diese Botschaften kommt. Innerhalb der Praxis kann man dies immer wieder sehr beeindruckend miterleben, dass psychischer Stress unterschiedlichste Gründe hat.
Neben emotionalem Stress, aufgrund eines Traumas (beispielsweise Tod einer nahestehenden Person, Vergewaltigung, Trennung), oder Beziehungsproblemen (die nicht selten durch den schon lange gehegten Kinderwunsch entstehen), kann sich auch berufsbedingter Stress negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken.
“Also vieles, das man auf den feinstofflichen Weg (in das Unterbewusste) in sich auf nimmt. Daneben gibt es noch Störungen durch das, was man stofflich (Bewusstes) in sich hinein gibt. Hier spricht man von einer psychogenen Fertilitätsstörung, fügt Souliotis hinzu.
Was ist eine psychogene Fertilitätsstörung?
” Von psychogener Fertilitätsstörung im engeren Sinne sprechen wir, wenn ein Kinderwunschpaar trotz Aufklärung, weiter fertilitätsschädigendes Verhalten praktiziert: falsche oder unzureichende Ehrnährung, Hochleistungssport, Genussmittel- und Medikamentenmissbrauch und extremer beruflicher Stress”, so Souliotis weiter.
Was sagt die Psychoanalyse dazu?
“Die psychoanalytisch-psychosomatische Forschung betrachtete das Nicht-Schwanger-Werden der Frau als Ausdruck ihrer unbewussten Abwehr.
Insbesondere die Frau wehrt sich unbewusst gegen ein Kind, häufig aufgrund ihrer Erfahrungen mit der eigenen Mutter. In der Praxis haben wir aber auch Männer gehabt, die mit solchen Erfahrungen zu tun haben. Deren eigene Mutter wollte nicht , dass Ihr Sohn ein Kind haben kann um glücklich zu sein, da sie selbst den Sohn ungewollt bekam und somit viele Dinge aufgeben musste und es immer schwer hatte. Dies zeigte sich auch darin das der Klient voll und ganz auf Karriere geschaltet hatte und unbewusst davor Angst hatte, für das Kind etwas aufgeben zu müssen”, weiß Ute Souliotis, ebenfalls vom aktipas®Institut, zu berichten.
Inwieweit spielt der Druck nicht schwanger zu werden eine Rolle?
“Ein weiterer nicht unerheblicher Anteil an der nicht Erfüllung entsteht durch den hohen Druck auf das Paar”, sagt Ute Souliotis.
” Sei es aufgrund der oft fehlgeschlagenen, reproduktionsmedizinischen Behandlungen, hier auch schon während der diagnostischen Phase, oder in der Wartezeit. Oder durch den hohen Erwartungsdruck von außen (na, immer noch nicht schwanger? Wollt ihr keine Kinder usw. usw.). All diese Dinge führen zu Blockaden und selbsterfüllenden Prophezeiungen, die es gilt aufzudecken und aufzuarbeiten”, so Olaf Souliotis weiter.
Hier hat sich innerhalb einer speziellen Kinderwunschtherapie die Zuhilfenahme der Bioenergetischen Regulationsverfahren in Kombination mit der Systemaufstellung, der Akupunktur und der aufdeckenden Hypnose als überaus fruchtbar erwiesen.
” Danach berichten die Paare, dass es vor allem in der Partnerschaft wieder besser funktioniert hat und auch der ersehnte Kinderwunsch bei einigen oft nicht lange auf sich warten ließ”, so Ute Souliotis abschließend.
Das Herz des aktipas®Institutes schlägt für die Familien, da wir wissen, dass das System Familie selten bis nie als Ganzes gesehen und somit auch nicht jeder mit in die Therapie einbezogen wird. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich die besten Erfolge (bis zu 90%) in der Therapie nur dann einstellen, wenn alle beteiligten bereit sind auch an und mit sich arbeiten zu lassen. Somit stehen wir allen aufgeklärten Menschen zur Verfügung, da diese genau wissen: Alles was geschieht, dient unserer Entwicklung und kann positiv beeinflusst werden; vorausgesetzt, man ist bereit an sich zu arbeiten.
Quelle: http://www.deaf-deaf.de/?p=197307
03.10.2011
Kosten der künstlichen Befruchtung
Die Krankenkasse hat die Kosten für eine künstliche Befruchtung mittels Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) nicht zu tragen, wenn die festgelegten Grenzwerte nicht erfüllt werden.
29.09.2011
Die Pille eignet sich nicht für jede
Kein Verhütungsmittel ist in Deutschland so beliebt wie die Pille. Vor allem junge Frauen nutzen sie gern, verspricht sie doch Sex ohne Angst. Allerdings sollten auch junge Frauen ihr persönliches Risiko abklären lassen. Vielen sind die familiären Risikofaktoren gar nicht bekannt.

Die Antibabypille steht noch heute wie kein anderes Verhütungsmittel für freie Lebensplanung und sexuelle Selbstbestimmung der Frau. In Deutschland ist die Pille auch 50 Jahre nach ihrer Einführung auf dem hiesigen Markt das mit Abstand beliebteste Verhütungsmittel.
Befragungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge verhüten 53 Prozent der Frauen mit der klassischen Pille, also einem Östrogen-Gestagen-Kombinationspräparat. 37 Prozent benutzen (oft als Ergänzung zur Pille) ein Kondom. Danach folgen Verhütungsmethoden wie die Spirale und die Sterilisation, dahinter Dreimonatsspritze oder Hormonstäbchen.
„Deutschland ist ein absolutes Pillen-Land“, sagt die Gynäkologin Anneliese Schwenkhagen. Die klassische Pille sei bequem anzuwenden, kostengünstig, zuverlässig und für junge, gesunde Frauen segensreich. Einem Kinderwunsch stehe sie nicht im Weg. „Die Pille schädigt die Fertilität nicht“, sagt Schwenkhagen. Anders die sogenannten Depot-Spritzen. Sie könnten, über einen langen Zeitraum hinweg gegeben, die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Denn die Hormone sammeln sich im Fettgewebe der Frau an und werden erst langsam wieder abgebaut.
Die regelmäßige Einnahme der Pille habe positive Effekte auf starke Regelblutungen und unregelmäßigen Zyklus, schwäche Regelschmerzen ab, könne Endometriose vorbeugen und lindere Beschwerden des prämenstruellen Syndroms. „Außerdem minimiert die Pille das Risiko, an Gebärmutterschleimhautkrebs und Eierstockkrebs zu erkranken“, sagt Schwenkhagen. Doch bei allen Vorzügen werde oft vergessen, dass die Pille nicht für jede Frau gleichermaßen geeignet sei.
Sie habe in ihrer Praxis für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin die Erfahrung gemacht, dass viele Patientinnen wenig oder gar nichts über ihre eigene Familiengeschichte erzählen können, sagt die Ärztin. „Gerade junge Frauen wissen oft nicht, welche Krankheiten in ihrer Familie vorkommen und ob und wie sie selbst vorbelastet sind.“ Diese Unwissenheit könne dazu führen, dass Frauen mit der Pille verhüten, obwohl sie damit ein hohes gesundheitliches Risiko eingingen. „Zu den Risikofaktoren gehören das Rauchen, Bluthochdruck, Migräne, Übergewicht oder Thrombosen in der Familie“, sagt Schwenkhagen. Wer familiär vorbelastet sei, sollte sich unbedingt für eine andere Verhütungsmethode entscheiden, rät Schwenkhagen. Ohne die Pille bekomme im Mittel jede vierte bis fünfte von 10 000 Frauen eine Thrombose, mit der Pille verdoppele sich dieses Risiko.
„Verhütung ist aber immer eine individuelle Abwägung von Risikofaktoren auf der einen Seite und dem psychosozialen Kontext auf der anderen Seite“, sagt Schwenkhagen. Vergesslich oder nicht? Unregelmäßiger Tagesablauf oder nicht? In den nächsten ein bis zwei Jahren ein Kinderwunsch oder nicht? All diese Fragen spielten eine Rolle. „Ist die Patientin dann über ihre Familiengeschichte informiert und sich selbst gegenüber ehrlich, findet man die ideale Verhütungsmethode“, sagt Schwenkhagen. Die Alternativen reichten von östrogenfreier Pille und Vaginalring bis zur Spirale.
Natürlich verhüten
Wer auf hormonelle Verhütung verzichten will, kann sich für die Natürliche Familienplanung (NFP) entscheiden. Dabei messen die Frauen ihre Körpertemperatur und beobachten den Zervixschleim in der Scheide. Er ist während der unfruchtbaren Tage kaum zu sehen und ist an fruchtbaren Tagen flüssiger, glasig und spinnbar.„Diese symptothermale Methode, also die doppelte Kontrolle aus Messen und Beobachten, ist grundsätzlich für fast jede Frau geeignet“, sagt Petra Frank-Herrmann, Gynäkologin an der Universitätsfrauenklinik Heidelberg.Frank-Herrmann hat 2007 mit einem internationalen Ärzteteam Daten von 900 Frauen ausgewertet, die mindestens ein Jahr mit der symptothermalen Methode verhüteten. Ergebnis: Diese Methode ist sehr sicher, wenn die Frauen in den circa zehn bis zwölf fruchtbaren Tagen pro Zyklus keinen Sex hatten oder ein Kondom benutzten.Selbst Frauen mit unregelmäßigem Zyklus oder Stewardessen, die häufig mit Zeitverschiebungen zu tun hätten, könnten auf diese Weise sicher verhüten. Voraussetzung sei, dass die Frauen motiviert seien und die Geduld aufbrächten, sich mit der Verhütungsmethode auseinanderzusetzen, sagt die Gynäkologin. „Auch wenn die Frauen vielleicht nicht dauerhaft auf die natürliche Weise verhüten wollen, rate ich dazu, es einmal drei Monate lang auszuprobieren“, sagt Frank-Herrmann. Man könne leichter zwischen normal und krankhaft unterscheiden und lerne, die Symptome für Fruchtbarkeit zu erkennen. „Wir wissen ja auch, dass wir Hunger haben, wenn der Magen knurrt“, sagt Frank-Herrmann. „Dieses Wissen sollte jede Frau auch über ihren Zyklus und seine Symptome haben.“
Quelle: http://www.suedkurier.de/news/dossiers/onlineplus/Die-Pille-eignet-sich-nicht-fuer-jede;art477507,5120998
26.09.2011
Unfruchtbar durch Magersucht
Die wenigsten Magersüchtigen Mädchen und Frauen sind sich der Folgen ihrer krankhaften Essstörung bewusst: Im schlimmsten Fall droht, selbst nach erfolgreicher Behandlung, die Unfruchtbarkeit.
Stark untergewichtige Frauen können unfruchtbar werden. "Bei vielen magersüchtigen oder Ess-Brechsucht-kranken Mädchen und Frauen bleibt die Periode irgendwann aufgrund des extremen Gewichtsverlustes aus", sagt der Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte (BVF), Christian Albring. "Je nachdem wie lange die Betroffene schon unter einer Essstörung leidet, kann diese sogenannte Amenorrhoe auch dauerhaft verbleiben."
Notzustand mobilisiert Reserven
Zusätzliche Hormonersatztherapie
Quelle: http://www.n24.de/news/newsitem_7278396.html
07.09.2011
SELEKTION BEI UNERWÜNSCHTEN
MEHRLINGSSCHWANGERSCHAFTEN
31.08.2011
BabyZauber – Kinderwunsch-Spezialisten
informieren über natürliche Alternativen

Filderstadt - Wunschkinder braucht das Land! Mit detailreichen Expertentipps rund um das Thema Kinderwunsch bietet das neue Internetportal BabyZauber.com leserlich aufgearbeitete Fachinformationen für Paare mit Kinderwunsch an, ohne Fachchinesisch zu sprechen. Der Fokus von BabyZauber.com liegt auf natürlichen Ansätzen, welche die Zeugung eines Kindes ohne hormonelle Kinderwunsch-Behandlung oder künstliche Befruchtung ermöglichen. Von frivolen Tipps zur besten Kinderwunsch-Stellungen, Teerezepten für die Fruchtbarkeit bis hin zu Diagnosehilfen von Hormonstörungen: Die hochwertigen Informationen von BabyZauber.com bieten für jedes Paar mit Kinderwunsch hilfreiche und alltagstaugliche Ratschläge.
Unerfüllter Kinderwunsch kann durch natürliche und effektive Methoden in ein Wunschkind gewandelt werden. Wenn es mit dem schwanger werden nicht klappt, wird oft all zu schnell eine belastende Kinderwunsch-Behandlungen wahrgenommen. Die Experten von BabyZauber.com bieten detailierte Informationen rund um mögliche Schritte, die vor einer solchen Therapie angegangen werden können, um auf natürlichem Wege schwanger zu werden. So kennen nur wenige die hochpräzise symptothermale Methode, welche mehrere Fruchtbarkeitsmerkmale der Frau in die Berechnung der fruchtbaren und sogar hochfruchtbaren Tage einbezieht. Das hier angewandte Double-Check-Verfahren ermöglicht eine hochgradig genaue Bestimmung des Befruchtungsoptimums. Dies kann auch bei Paaren, bei denen ein oder beide Partner unter verminderter Fruchtbarkeit leiden, eine erfolgreiche Zeugung stark begünstigen.
Zur Vorbereitung einer Schwangerschaft gehören Arztbesuche. Welche Untersuchungen machen bei Frauen Sinn, welche bei Männern? Können Personen, deren Herkunft aufgrund einer Adoption nicht eindeutig festzustellen ist herausfinden, ob sie gesundes Erbgut in sich tragen? Hilft Zykluswissen auch potentiellen Papas bei der Zeugung von Nachwuchs? Diese Fragen und viele mehr werden auf BabyZauber.com beantwortet.
Um den Start von BabyZauber.com gebührend zu feiern, werden noch bis zum 31. Oktober 2011 Kinderwunsch-Sets im Wert von über 30.000 Euro verlost, die je einen wertvollen symptothermalen Zykluscomputer cyclotest baby und zugehörige cyclotest Wunschkind-Produkte enthalten. Mehr Informationen rund um das Thema Kinderwunsch sind zu finden unterhttp://www.babyzauber.com
Quelle: http://gesundheit-adhoc.de/index.php?m=1&showPage=1&id=11008
22.08.2011
Immer unter Strom, aber im Bett ohne Energie
17.08.2011
Übergewichtige Männer offenbar weniger
fruchtbar
Übergewicht kann bei Männern Fruchtbarkeit beeinflussen. Übergewichtige Männer sind oftmals weniger fruchtbar als ihre normalgewichtigen Geschlechtsgenossen. Das ergab eine Studie der Eylau-Unilabs aus Paris, die auf einer Konferenz der European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) in Stockholm vorgestellt wurde. Die Forscher verglichen dabei die Spermaqualität von knapp 2.000 Männern.
Demnach sank die Anzahl der Spermien bei übergewichtigen Männern um bis zu zehn Prozent. Bei fettleibigen Männern wurden sogar bis zu 20 Prozent weniger Spermien festgestellt. Frühere Untersuchungen hatten bereits für Frauen einen Zusammenhang zwischen Fruchtbarkeit und Körpergewicht festgestellt.
Quelle: http://www.sex-up.net/uebergewichtige-maenner-offenbar-weniger-fruchtbar-suid6627/
08.08.2011
Reproduktionsärzte klären Ehepaare nicht genug auf
02.08.2011
RISIKEN DER KINDERWUNSCH-/IVF-BEHANDLUNG
Follikelpunktion
zusätzlich könnte eine vielleicht notwendige Narkose den Körper belasten.
Auch könnten bei einer ultraschallgeführten Follikelpunktion
Komplikationen auftreten, zum Beispiel Verletzungen
der Nachbarorgane; dieses Risiko ist jedoch äusserst niedrig.
Mehrlingsschwangerschaft
die Schwangerschaftsrate.
So liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zwillingsschwangerschaft
bei ca. 16 bis 18%.
Eileiterschwangerschaft
Trotz fachgerechtem Einsetzens kann es daher zu einer
Eileiterschwangerschaft (Extrauteringravidität) kommen.
Durch regelmässige Kontrolle und sofortige Therapie
läßt sich das Risiko von Komplikationen minimieren.
Für das Risiko von Schwangerschaftskomplikationen und
Kindesfehlbildungen besteht nach einer IVF-Behandlung kein
Unterschied zu einer natürlich entstandenen Schwangerschaft.
Fehlgeburt
einer Fehlgeburt. Bei IVF sind es etwa 12 bis 15%,
je nach zugrundeliegender Problematik.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen :
Das Durchschnittsalter der Frauen, die sich für eine IVF-Behandlung
entschieden haben, ist höher als das auf natürlichem Weg
schwanger gewordener Frauen.
Und mit erhöhtem Alter steigt auch die Fehlgeburtenrate
naturgegeben an.
Ovarielles Hyperstimulationssyndrom ( OHSS )
Je mehr Follikel heranreifen, desto grösser werden die Eierstöcke.
Mehrere Follikel und grössere Eierstöcke sind also bei einer
Stimulation ganz normal; das muß auch so sein,
damit der erste Schritt der IVF-Behandlung ein Erfolg wird -
das Heranreifen mehrerer Eizellen.
im Einzelfall zuviel sein und zu einer deutlichen Überfunktion
der Eierstöcke führen.
Erst jetzt sprechen wir von OHSS.
Dabei kann sich Flüssigkeit im Bauchraum bilden (Aszites),
und es können Unterleibsschmerzen auftreten.
In wenigen Fällen ist die Vergrösserung der Eierstöcke so stark,
daß zur besseren Überwachung und Behandlung ein
stationärer Krankenhausaufenthalt erforderlich wird.
Schwangerschaft
schliesslich wünschen Sie sich ein Kind.
Allerdings kann eine Schwangerschaft zu Komplikationen führen.
Auch das Risiko eines genetischen oder angeborenen Defektes
oder einer Totgeburt ist nicht ausgeschlossen.
Diese Risiken sind bei einer IVF-Schwangerschaft weder höher
noch niedriger als bei einer "normalen" Schwangerschaft -
unabhängig davon, ob ICSI eingesetzt wird oder nicht.
25.07.2011
Gynäkologe vor Gericht
18.07.2011
PHOENIX-Sendeplan für Dienstag, 19. Juli 2011
THEMA: Kinderwunsch
13:00
Ich will ein Baby ohne Mann Film von Iris Bettray, ZDF/2010 Ein Baby auch ohne Mann, Kinderkriegen im Alleingang? In Zeiten der Reproduktionsmedizin ist das machbar und für Frauen, die auf "natürlichem Weg" nicht schwanger werden, immer mehr eine Alternative. Schwanger zu werden über Samenbanken ist in Amerika und in vielen europäischen Nachbarländern für alleinstehende Frauen längst etabliert, in Deutschland hingegen hat der Gesetzgeber noch keine klaren Richtlinien für die Betroffenen geschaffen. Denn Frauen, die sich ihr Mutterglück durch eine Samenbank erfüllen wollen, müssen sich mit komplexen moralischen Fragen auseinandersetzen. Welche Bedeutung wird der anonyme Vater künftig im Leben des Kindes spielen? Wie gehen sie mit den kritischen Reaktionen der Umwelt, der Familie, des Arbeitgebers und des Freundeskreises um? Werden Sie der Rolle als alleinerziehende Mutter gerecht? Der Film begleitet drei Frauen auf ihrem Weg, den größten Wunsch zu erfüllen.
13:30
Risiko Kind (Aktualisierte Fassung) Wohin führt die PID? Film von Silvia Matthies, BR/2011 Die einen möchten die Präimplantationsdiagnostik in Deutschland verbieten, die anderen zulassen - in definierten Grenzen und kontrolliert von Ethikkommissionen. Seit der BGH-Entscheidung vom Juli 2010, die die PID für schwere Erkrankungen als zulässig bezeichnete, herrscht in Deutschland Unsicherheit, ein Reproduktionsmediziner bezeichnet das Thema gar als "rechtsfreien Raum". Denn kollidiert die Zulassung nicht mit den Grundsätzen des Embryonenschutzgesetzes? Und was ist eine schwere Krankheit und was nicht? Der Film beleuchtet die medizinische, gesellschaftliche und ethische Dimension der Präimplantationsdiagnostik und analysiert Haltung und Argumente der Gegner wie der Befürworter.
14:15
Gefahr Weichmacher Film von Inge Altemeier, NDR/2010 Die Hälfte aller jungen Männer in Deutschland ist nur noch eingeschränkt fruchtbar. Ihre Spermien sind für eine natürliche Befruchtung zu wenig und zu langsam. Der Film macht sich auf die Suche nach den Ursachen für die zunehmende männliche Unfruchtbarkeit - und wurde bei Wissenschaftlern in London, Kopenhagen und Berlin fündig: Schuld sind vor allem sogenannte Weichmacher, die uns überall im Leben begegnen.
Quelle: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-07/20815595-phoenix-sendeplan-fuer-dienstag-19-juli-2011-mit-folgenden-tages-tipps-15-30-uhr-anhoerung-von-rupert-und-james-murdoch-vor-dem-britischen-parlame-007.htm
13.07.2011
Eingefrorene Embryos werden häufiger
Riesen-Babys
In zwei Studien haben Forscher unabhängig voneinander entdeckt, dass Babys größer werden, wenn die Befruchtung künstlich vonstatten ging. Nun suchen sie nach dem Grund.

FOTO: PICTURE-ALLIANCE / AGENCIA ESTAD/AGENCIA ESTADODieses auffällig große Baby wurde mit 7,7 Kilogramm Gewicht im Nordosten Brasiliens geboren
Ob ein Kind auf natürliche Weise oder per künstlicher Befruchtung gezeugt wurde, kann sich auf seine Größe im Mutterleib und bei der Geburt auswirken. Embryonen, die vor dem Einpflanzen in die Gebärmutter eingefroren waren, werden signifikant häufiger zu groß und zu schwer für ihr Alter.
05.07.2011
Übergewicht mindert Spermien-Qualität
Offenbar mindert Übergewicht die Sperma-Qualität bei Mann

Laut einer Studie des französischen Labors Eylau-Unilabs in Paris nimmt die Sperma-Qualität in Folge der Körperfettzunahme ab. Um so höher das Gesamtgewicht ausfiel, um minderer fiel die Qualität der Samenzellen aus.
Übergewichtige Männer tendieren offenbar stärker als bislang vermutet zur Unfruchtbarkeit. Auf der internationalen Fruchtbarkeitskonferenz in Stockholm stellten Mediziner eine Studie vor, bei der nachgewiesen wurde, dass die Qualität des Spermas abnimmt, um so höher das Körpergewicht eines Mannes ausfällt. Um diesen Kontext herzustellen, werteten die Wissenschaftler die Proben von rund 2000 erwachsenen Männern aus. Eine derart hohe Probanden-zahl habe es nach Angaben der Forscher bislang in diesem Zusammenhang noch nicht gegeben. Damit sei die Studie die bislang umfangreichste in seinem Fachgebiet. Bereits durchgeführte Studien zur Thematik konnten einen Zusammenhang bei Frauen in Bezug auf Fruchtbarkeit und Gewicht herstellen. Eine ältere Studie verwies ebenfalls in die gleiche Richtung.
Paul Cohen-Bacrie berichtete auf der Konferenz, dass mit der Körpergewicht-Zunahme nicht nur weniger Samenzellen produziert werden, sondern diese auch noch langsamer und kurzlebiger sind. Die Forscher vermuten, dass das Übergewicht das körpereigene Hormonsystem störe. Demnach verfügen übergewichtige Männer durchschnittlich zehn Prozent weniger Samenzellen. Wer an Adipositas leide, bei dem sind es sogar gute 20 Prozent weniger. Als Maßgebung fürs Übergewicht verwendeten die Mediziner den sogenannten Body-Mass-Index (BMI), der das Körpergewicht eines Menschen in Beziehung zu seiner Körpergröße setzt.
Eine Studie der University of Southern Denmark aus dem Jahre 2004 kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Auch dort wurde das Körpergewicht und die Sperma-Konsistenz überprüft. Übergewichtige hatten eine um 24 Prozent geringere Spermidinkonzentration, als Normalgewichtige. Reduzierten die Männer ihr Körpergewicht, so verbesserte sich die Qualität. An dieser Studie nahmen rund 1500 Männer aus Amsterdam und Aalborg teil.
Quelle: http://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/uebergewicht-mindert-sperma-qualitaet-89833.php
27.06.2011
KINDERWUNSCH
Altersgrenze nur für Frauen?

Mutterglück mit 54! Das ist mal eine echt späte Schwangerschaft, dachten sich nicht nur die Italiener, als deren liebste Rockröhre Gianna Nannini ihren runden Bauch präsentierte. Während Vaterfreuden jenseits der 50 als ganz normal gelten, müssen sich Frauen wie Nannini nicht nur schräge Blicke gefallen lassen. Ist das nicht unfair? Warum müssen späte Mütter viel mehr Kritik einstecken als späte Väter?
"Von den Männern redet da niemand"
Immer mehr werden erst mit 50 Vater
Die Natur räumt Männern mehr Zeit ein - basta?
Und auf der anderen Seite sind da die Männer, denen die Natur mehr Zeit einräumt und bei denen Nachwuchs im hohen Alter gerne als Ausdruck großer Lebensfreude gefeiert wird. Ungerecht - aber so ist es halt?
Quelle: http://www.eltern.de/kinderwunsch/familienplanung/gianna-nannini.html
24.06.2011
Strengere Regeln für Retorten-Babys
Künstliche Befruchtung: Die moderne Fortpflanzungsmedizin ist mit vielen Risiken verbunden - Experten fordern nun strengere Gesetze.

Riskante Mehrlingsschwangerschaften - wie der Extremfall der Fünflinge, die kürzlich im Wiener AKH auf die Welt kamen - sorgen immer öfter für Diskussionsstoff rund um das Thema künstliche Befruchtung (In-vitro-Fertilisation, IVF) . Während die Geburtenrate von 2,8 Kindern pro Frau in den 1960er-Jahren auf mittlerweile 1,4 Kinder gesunken ist, stieg der Anteil der Frühgeborenen auf derzeit 11,1 Prozent.
"Im Europa-Vergleich haben wir einen Spitzenplatz", warnt Neonatologin Univ.-Prof. Angelika Berger von der MedUni Wien. Der Durchschnitt liege bei 7,1 Prozent - Schweden habe sogar nur eine Frühgeborenen-Rate von 5,9 Prozent. "Diese hohe Zahl ist zwar auch auf den Anstieg des Alters der Gebärenden zurückzuführen, aber die IVF leistet ebenso einen negativen Beitrag."
Positionspapier

 Extremfall: Den Fünflinge im AKH hatten Glück, es geht ihnen gut.Die österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit hat am Montag daher - im Vorfeld zu einer Enquete der Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes - ein Positionspapier vorgestellt, das Frühgeburten durch Mehrlingsschwangerschaften nach IVF reduzieren soll.
Extremfall: Den Fünflinge im AKH hatten Glück, es geht ihnen gut.Die österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit hat am Montag daher - im Vorfeld zu einer Enquete der Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes - ein Positionspapier vorgestellt, das Frühgeburten durch Mehrlingsschwangerschaften nach IVF reduzieren soll.- "Erfolg wird in der Fortpflanzungsmedizin meist in Schwangerschaftsraten angegeben. Diese spiegeln aber nur die halbe Wahrheit", sagt Univ.-Prof. Barbara Maier, Leiterin der Arbeitsgruppe Reproduktionmedizin des Gesundheitsministeriums. Es sei daher notwendig, eine sogenannte Baby-take-home-Rate zu erheben. Diese erfasst, wie viele Kinder nach Unterstützung durch Reproduktionsmedizin (IVF, Hormonstimulation, Insemination, Samen- und Eizellspende) geboren wurden.
Optimal wäre eine qualitative Erhebung, die zudem angibt, wie gesund die Kinder zur Welt kommen. Erste Auswertungen (über den IVF-Fonds seit Jänner 2010 verpflichtend) zeigen eine Baby-take-home-Rate von etwa 20 Prozent.
Risiko
- Bisher erstattet der IVF-Fonds für vier Zyklen 70 Prozent der Kosten zurück. Um den Erfolgsdruck zu nehmen, soll diese Limitierung aufgehoben werden.
Während der Oberste Sanitätsrat und das Gesundheitsministerium sich den Forderungen weitestgehend anschließen, sind Reproduktionsmediziner wie Wilfried Feichtinger vom Wunschbaby-Zentrum skeptisch: "Der Ruf nach dem Gesetzgeber ist kontraproduktiv und schränkt das ärztliche Handeln ein. Es liegt im Verantwortungsbereich jedes einzelnen Reproduktionsmediziners, den besten Weg auszusuchen. Es gibt viele Gründe, warum man im Individualfall anders handelt."
19.06.2011
EHEC - Sicherheitshinweise für Frauen mit Kinderwunsch und Schwangere
Die Hauptansteckungsgefahr ist immer noch die Aufnahme der Bakterien durch den Mund.
Der direkte Kontakt mit Tieren oder deren
Ausscheidungen sowie durch den Verzehr
von kontaminierten Lebensmitteln ist ein
weiterer Ansteckungsweg.Im Verdacht steht ungewaschene Rohkost wie Obst und Gemüse, zum Beispiel Blattsalate, Salatgurken und rohe Tomaten.Das Trinken kontaminierten Wassers (z. B. Badegewässer) kann ein weiterer Ansteckungsweg sein.
Mangelde Hygiene sorgt dafür das der Erreger von Mensch zu Mensch wandert.
Im Grunde sind alle Altersgruppen betroffen. Besonders gefährdet sind aber Säuglinge, Schwangere, Kinder und ältere abwehrgeschwächte Menschen. In der Vergangenheit waren oft Kinder betroffen.
Inzwischen sind es aber oft erwachsene Frauen.
Bei schwerem Verlauf drohen Nierenversagen, Blutarmut durch den Zerfall roter Blutkörperchen und einem Mangel an Blutplättchen. Bei Kindern treten in fünf bis zehn Prozent der Fälle schwere Komplikationen auf.
Wässriger Durchfall, teilweise blutig,
Übelkeit, Erbrechen oder Bauchschmerzen.
Die Infektion kann ohne Beschwerden verlaufen und somit unerkannt bleiben.
Bei zehn bis 20 Prozent der Erkrankten entwickelt sich als schwere Verlaufsform eine blutige Darmentzündung mit krampfartigen Bauchschmerzen, blutigem Stuhl und teilweise Fieber.
Hände regelmäßig gründlich waschen, besonders nach Tier- und Bodenkontakt.
Beim Kochen Lebensmittel durchgaren, das heißt mindestens zehn Minuten bei 70 Grad.
Brettchen, Besteck und Geschirr gründlich spülen. Keine Rohmilch trinken
Bei massiven Durchfällen ist der Ausgleich des Salz- und Flüssigkeitsverlustes die
wichtigste therapeutische Maßnahme. Also: Viel trinken! Bei schweren Beschwerden sollte sofort der Arzt aufgesucht werden.
14.06.2011
IVF, ICSI & CO.
Chancen und Risiken der Reproduktionsmedizin
Für so manches Paar ist eine Behandlung wie die IVF die letzte Chance auf ihr Wunschkind. Doch wie jeder Eingriff sind auch sie mit gewissen Risiken verbunden. Ein kurzer Überblick.

Chancen
Risiken
- Die hormonelle Stimulation kann zu einer deutlichen Überfunktion der Eierstöcke führen. Man nennt dies Ovarielles Hyperstimulationssyndrom (OHSS). Durch die erhöhte Durchlässigkeit der Gefäße kann sich Wasser im Bauchraum oder im Gewebe sammeln. Daneben kann das Blut eindicken und es können sich im schlimmsten Fall Blutgerinnsel bilden. Oft bestehen auch Atemnot oder es kommt zu Problemen mit der Nierenfunktion.
- Bei der IVF-Behandlung können laut deutschem Embryonenschutzgesetz bis zu drei befruchtete Eizellen übertragen werden. Da die Wahrscheinlichkeit einer Mehrlingsschwangerschaft so erhöht wird, übertragen die Mediziner in der Regel heute bei unter 38-jährigen Frauen aber maximal zwei Eizellen.
- Acht bis zehn Prozent aller Schwangerschaften in Deutschland führen zu einer Fehlgeburt. Nach einer IVF ist dieses Risiko leicht erhöht auf etwa 15 Prozent. Einer der Gründe: Das Risiko einer Fehlgeburt steigt mit dem Lebensalter an.
- Zwar ist die Gefahr einer Eileiter-Schwangerschaft nach einer IVF-Behandlung relativ gering - gleichwohl besteht ein gewisses Risiko, vor allem bei vorgeschädigten Eileitern.
05.06.2011
Der Preis der Kinderlosen
Dass ein Mensch mit Segelohren psychisch mehr leiden soll als einer mit unerfülltem Kinderwunsch, klingt wie Hohn. Einerseits. Doch andererseits ist Kinderlosigkeit oft auch ein selbstgewähltes Schicksal. Warum es zweifelhaft ist, wenn sich der Staat an den Kosten künstlicher Befruchtung beteiligt.
30.05.2011
URTEIL ZU KÜNSTLICHER BEFRUCHTUNG
Unfruchtbarkeit eines Ehepaares ist keine
"Krankheit"
 Keine ganz einfache Frage hatten die Richter des Bundesverfassungsgerichts da zu beantworten: Ist die Unfruchtbarkeit eines Ehepaares eine Krankheit? Und müssten die Krankenkassen dann die Heilung dieser Krankheit, also eine künstliche Befruchtung, nicht voll bezahlen - wie sie es bei anderen Therapien auch tun? Nein, entschieden die Richter. Künstliche Befruchtung zielt nicht auf Heilung, sondern auf Umgehung der Unfruchtbarkeit.
Keine ganz einfache Frage hatten die Richter des Bundesverfassungsgerichts da zu beantworten: Ist die Unfruchtbarkeit eines Ehepaares eine Krankheit? Und müssten die Krankenkassen dann die Heilung dieser Krankheit, also eine künstliche Befruchtung, nicht voll bezahlen - wie sie es bei anderen Therapien auch tun? Nein, entschieden die Richter. Künstliche Befruchtung zielt nicht auf Heilung, sondern auf Umgehung der Unfruchtbarkeit.Die künstliche Befruchtung ist keine Heilung
Ungleichbehandlung gegenüber anderen Kranken?
Keine staatliche Verpflichtung
Künstliche Befruchtung nur für Besserverdienende?
27.05.2011
Hormonbehandlung
Krebsfalle unerfüllter Kinderwunsch?
Der Verdacht ist nicht neu, aber jetzt mehren sich die Indizien. Die hormonelle Behandlung, die bei der künstlichen Befruchtung angewendet wird, erhöht anscheindend das Risiko an Brust- und Gebärmutterkrebs zu erkranken.
Bestehende Krebszellen angeregt
Die Behandlungsprotokolle für die Kinderwunschtherapie sind nicht einheitlich. Ziel ist es jedoch, den natürlichen Zyklus zu unterlaufen. Je nach Hormondosis werden bis zu zehn, mitunter dreißig Eizellen für eine künstliche Befruchtung zum Reifen gebracht. Clomifenzitrat wird meist im Vorfeld eingesetzt, um der natürlichen Zeugung noch eine Chance zu geben.Je häufiger die oberflächliche Epithelschicht der Eierstöcke im Zuge eines Eisprungs verletzt und gereizt wird, desto größer ist das Risiko, dass sich hier ein Tumor entwickelt. Daher sind Eierstockstumore bei Frauen, deren Eierstöcke während ihrer Schwangerschaften längere Zeit zur Ruhe kamen, deutlich seltener als bei jenen, die nie Kinder geboren hatten. Eine Schutzwirkung entfaltet aber auch die Pille, wenn zur Verhütung der Eisprung unterdrückt wird.
An den Oberflächenzellen der Eierstöcke befinden sich Bindungsstellen für Gonadotropine. Sind bereits entartete Krebszellen vorhanden, so werden sie durch die Hormone zur weiteren Expansion angetrieben. Das bietet eine Erklärung für die Beobachtung, dass sich mitunter rasch nach einer künstlichen Befruchtung ein Ovarialtumor entwickelt. Daher empfehlen manche Experten, vor einer Behandlung nach Anzeichen für bereits bestehende Tumorherde zu fahnden.
Auch höheres Brustkrebsrisiko
Israelische Forscher haben Eierstockzellen, die von Patientinnen stammten, die sich einer künstlichen Befruchtung unterzogen, im Labor den stimulierenden Gonadotropinen ausgesetzt. Sie konnten zeigen, dass dadurch beispielsweise Krebswachstumsfaktoren, etwa das Epiregulin, dramatisch angekurbelt werden.Wenngleich die meisten Beobachtungen keine übermäßig erhöhten Risiken erkennen ließen, stimmen doch zwei Aspekte bedenklich. Denn sowohl dann, wenn die Frauen länger beobachtet wurden, oder dann, wenn sie größeren Mengen an stimulierenden Substanzen ausgesetzt waren, wurde eine Zunahme der Krebsrate beobachtet. Das gilt auch für Tumoren der Gebärmutter. Das Risiko für die Entwicklung eines Brustkrebses infolge einer künstlichen Befruchtung erhöht sich nur dann, wenn zusätzlich Progesteron bei der Stimulation verwendet wird.
Nichtmedizinische Motive
Da die Generation derjenigen Frauen, von denen erstmals viele mit sehr hohen Hormondosen behandelt wurden, erst allmählich in das kritische Alter kommt, in dem diese Krebsarten ausbrechen, mahnen diese Erkenntnisse nach Ansicht von Louise Brinton zur Vorsicht. Diese Frauen sollten künftig sorgfältig beobachtet werden. Allerdings finden bisher die gleichzeitig immer häufiger erhobenen Aufrufe, auch bei der künstlichen Befruchtung nur die in einem natürlichen Zyklus herangereiften Zellen zu nutzen und auf starke Hormonanreize zu verzichten, kaum Gehör. Es gibt inzwischen Belege, dass die Qualität der ohne Hormonstimulation herangereiften Eizellen deutlich besser ist. Es zeigte sich außerdem, dass die Hormongabe dem Embryo die Einnistung verwehrt. Das molekulargenetische Muster der Schleimhautzellen ist dann nämlich nicht wie bei der natürlichen Empfängnis für einen freundlichen Empfang zusammengesetzt, sondern eher ungünstig, so wie in der unfruchtbaren Periode des Zyklus.Für die Stimulation sprechen eigentlich eher nichtmedizinische Gründe, meint Boon Chin Heng von der Nationaluniversität in Singapur in einem Begleitartikel. Zunächst sei der Profit der Reproduktionsmediziner geringer. Außerdem stünden weniger überzählige Eizellen zur Verfügung, die nach Einfrieren zur Wiederverwendung, aber auch zum Spenden an andere Frauen genutzt werden können. Schließlich trügen auch die Krankenkassen hierfür Verantwortung. Da sie die Zuzahlung auf eine bestimmte Anzahl von Versuchen beschränkten, trieben sie Ärzte und Paare dazu, gleich zu Beginn der Behandlung so viele Eizellen wie möglich gewinnen zu wollen.
Homepage: http://www.faz.net/artikel/C30565/hormonbehandlung-krebsfalle-unerfuellter-kinderwunsch-30199508.html
25.05.2011
Psychosomatik bei unerfülltem Kinderwunsch
DIE THEMEN
- Naturheilkunde bei unerfülltem Kinderwunsch
- Ursachen und Diagnose bei unerfülltem Kinderwunsch
- Schulmedizin bei unerfülltem Kinderwunsch
- Die Naturheilkunde bei unerfülltem Kinderwunsch
- Was Sie selbst tun können bei unerfülltem Kinderwunsch
- Psychosomatik bei unerfülltem Kinderwunsch
- Literatur- und Linktipps bei unerfülltem Kinderwunsch
Psychosomatik bei unerfülltem Kinderwunsch
Die Psychotherapie und die Naturheilkunde bieten vielfältige Ansätze zur Lösung solcher Blockaden. In der Regel ist eine Kombination verschiedener Therapien möglich. Dies sollten Sie im Einzelfall mit Ihrem Therapeuten besprechen. Zur Lösung emotionaler Blockade beim unerfüllten Kinderwunsch eignen sich z.B.:
- Psychotherapie
- Bachblüten
- Bioresonanzverfahren
- Mind link nach Dr. J. Lechner
- Ohrakupunktur
- Heilsteine
- Farbtherapie und Aromatherapie
- Psychokinesiologie nach Dr. Klinghardt
- Erlernen emotionaler Stressreduktionstechniken
Homepage: https://www.naturheilmagazin.de/autorenbereich/unerfuellter-kinderwunsch/kinderwunsch-psychosomatik.html
18.05.2011
Der kostspielige Weg zur Elternschaft

Für viele Paare mit unerfülltem Kinderwunsch ist sie die letzte Hoffnung: die moderne Reproduktionsmedizin. Doch dabei kommen hohe Kosten auf sie zu.
Teurer Kinderwunsch
Ungewollt Kinderlose in der gesetzlichen Krankenversicherung
- Sie müssen verheiratet sein.
- Die Frau darf nicht jünger als 25 und nicht älter als 40 Jahre alt sein.
- Der Mann darf nicht älter als 50 Jahre sein.
- Es muss ein ausreichender Schutz gegen eine Röteln-Infektion bestehen.
- Die Kinderlosigkeit darf nicht mit anderen Maßnahmen zu beheben sein.
- Es dürfen nur Ei- und Samenzellen der Ehepartner verwendet werden.
- Auch ein negativer HIV-Test ist Voraussetzung für eine Kostenerstattung - obwohl gerade die HIV-Infektion des einen oder anderen Partners ein Grund für die Durchführung einer künstlichen Befruchtung sein kann.
09.05.2011
Die kontrollierte Geburt
Zwei Fehlgeburten hatte die 38-jährige Frau schon hinter sich. Die dritte Schwangerschaft endlich schien erfolgreich zu verlaufen. "Alles in Ordnung" hieß es bei den regelmäßigen Kontrolluntersuchungen. Bis sie in der 26. Woche eines Morgens ein Ziehen im Bauch spürte. Drei Stunden später war sie in der Freiburger Uniklinik. "Alarmstufe rot", erkannten die Ärzte, als sie der viel zu langsamen Herzfrequenz des Kindes gewahr wurden. Innerhalb von zehn Minuten hatten sie das 650 Gramm leichte Wesen per Kaiserschnitt in die Welt geholt. Zehn Minuten später, und es wäre tot gewesen. Der Mutterkuchen hatte sich vom Gebärmutterboden gelöst und den Embryo nicht mehr mit Nährstoffen versorgt. Dank intensivmedizinischer Behandlung mit künstlicher Beatmung und Ernährung im wärmenden Brutkasten überlebte das Kind. Nach drei Monaten konnten die glücklichen Eltern Valentina mit nach Hause nehmen.
Natürlich hätten sie sich einen glücklicheren Start in das Leben zu dritt gewünscht: Mit sanfter Musik, Wellnesstinkturen, Akupunktur oder homöopathischen Mitteln, vielleicht einem kleinen Entspannungsbad vor der Geburt. Aber immer mehr Elternpaaren bleibt genau wie Valentinas Mutter und Vater die Chance verwehrt, eine solche Geburt nach Wunsch zu erleben.
Der Grund: Die Zahl der komplizierten Geburten und der Neugeborenen, die eine intensiv-medizinische Betreuung benötigen, steigt kontinuierlich. Das zunehmende Durchschnittsalter der Eltern, die größeren Möglichkeiten der Frauenärzte, die immer mehr Kinder im Mutterleib retten können, und die Nachfrage in Sachen künstlicher Befruchtung, die wiederum mit mehr Mehrlingsschwangerschaften verbunden ist, fordern ihren Tribut. Denn kompliziertere und gefährlichere Geburten verlangen auch immer öfter den Einsatz von komplizierteren Verfahren und Hightechmedizin.
Das Wohlfühlspektrum, das Hebammen anzubieten haben, um Eltern und Kind dieses einschneidende Datum in ihrer Biografie so angenehm wie möglich zu gestalten, verliere aber deshalb in der Geburtsmedizin keinesfalls an Stellenwert, sagt Heinrich Prömpeler, Ärztlicher Leiter der Geburtshilfe in der Freiburger Uniklinik. "Alles, was hilft, ist gut. Aber man darf auch nicht vergessen: Wir müssen schnell reagieren können, wenn etwas schief läuft."
Selbst nach einer unkomplizierten Schwangerschaft muss heute bei rund jeder siebten Geburt mit unvorhersehbaren Zwischenfällen wie starken Blutverlusten der Mutter gerechnet werden. Von den 89 700 Kindern, die 2009 in Baden-Württemberg zur Welt kamen, mussten 13 330 gleich nach der Geburt in einer Kinderklinik aufgenommen werden. Ähnliche Tendenzen zeigen sich auch bei den außerklinischen Geburten: Laut einer Untersuchung Berliner Hebammen, so Prömpeler, bringe ein Drittel der Frauen, die ihr Kind zuhause oder in einem Geburtshaus entbinden wollten, ihr Baby letztendlich doch in einer Klinik zur Welt – in der Regel wegen medizinischer Probleme während des Geburtsprozesses.
Transfusionsmedizin und Blutbank, Gerinnungsspezialisten, Narkoseärzte, eine eingespielte Organisationsstruktur und eine hoch spezialisierte Technik wie Doppler-Ultraschall, Überwachungsmonitore oder Beatmungsgeräte für das Kind helfen, dass Mutter und Kind auch im Notfall und bei Komplikationen überleben können.
Auch Roland Hentschel, der Leiter der Neugeborenen- und Intensivmedizin der Freiburger Unikinderklinik verzeichnet steigende Behandlungszahlen: "Bis zu 60 Prozent der stationären Patienten in Kinderkliniken sind heute Neugeborene." Dass die Zahl der Risikogeburten zunimmt, spiegele eine gesellschaftliche Entwicklung wider: Um den Anschluss im Beruf nicht zu verpassen, entscheiden sich Frauen immer später für ein Kind. Im Jahr 2000 waren die Gebärenden durchschnittlich drei Jahre älter als noch zwanzig Jahre zuvor. In der Freiburger Uniklinik sind 40 Prozent älter als 35, gar nicht so selten sogar 45- oder 46 Jahre alt.
Wenn der späte Kinderwunsch sich nicht erfüllen will, verspricht die Reproduktionsmedizin neue Hoffnungen. Sie sind ebenfalls nicht ohne Risiken zu haben: Nach einer künstlichen Befruchtung sind Geburtskomplikationen häufiger – nicht nur im Fall einer ebenfalls wahrscheinlicheren Mehrlingsgeburt.
Zu den häufigsten gehört eine Frühgeburt: Seit 1996 ist die Zahl der Kinder, die vor der 28. Schwangerschaftswoche (planmäßig ist die 40.) geboren wurden um mehr als 50 Prozent gestiegen. Das liegt unter anderem daran, dass mit dem Alter der Mütter auch die Gefahr steigt, dass der Mutterkuchen nicht richtig arbeitet und das Kind mangelernährt wird. Die Folge: Der Embryo kann sich nicht adäquat entwickeln. Es kann zu Fehlbildungen kommen. Nicht leichter wird die Arbeit der Geburtshelfer durch die dunklen Seiten der Wohlstandsgesellschaft. Gerade bei älteren Schwangeren bereiten ihnen Übergewicht, Bluthochdruck und ein während der Schwangerschaft erworbener Diabetes zunehmend Probleme.
Es gibt aber noch eine andere Seite der Medaille. Gynäkologen und Neonatologen sind auch deshalb mehr gefordert, weil die moderne Medizin heute manchmal auch jenen Frauen zu einem Kind verhilft, denen die Ärztinnen und Ärzte vor zehn Jahren noch dringend davon abgeraten hätten: Frauen mit einem angeborenen Herzfehler, nach einer Organtransplantation oder mit einer Niereninsuffizienz, für die eine Schwangerschaft früher einem Todesurteil gleichgekommen wäre.
Obwohl immer mehr Kinder immer früher zur Welt kommen, ist die Neugeborenensterblichkeit von 1962 bis heute von 35 auf acht Prozent zurückgegangen. Lässt man die Zunahme an Frühgeburten dabei außer Acht, ist sie sogar auf unter ein Prozent gesunken. Mit zu den Erfolgen beigetragen hat zum Beispiel eine immer differenzierter gewordene und engmaschigere Überwachung. Etwa mit dem Doppler-Ultraschallverfahren, das Kreislauf und Durchblutung des Embryos misst.
Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse zu, ob sich das Kind normal entwickelt. Bleibt es zu klein und schwach oder wächst es vielleicht gar nicht mehr weiter, hilft die Technik bei der Entscheidung, wie lange es noch im Bauch der Mutter bleiben kann.
Gleichzeitig bringen die neuen Möglichkeiten aber auch neue Konflikte mit sich. Was soll zum Beispiel ein Arzt den Eltern raten, wenn bei einer Zwillingsschwangerschaft nur einer der beiden Embryos gut von einer normal arbeitenden Plazenta versorgt wird. Und der andere, weil er von einem schlecht arbeitenden Mutterkuchen zu knapp gehalten wird, sich nur schlecht entwickelt und Bruder oder Schwester gefährdet? Die Eltern müssen mit entscheiden, was zu tun ist: Verhilft die Hightech-Medizin auch dem kleinen und schwachen Zwilling zum Leben, stößt sie den großen gesunden "runter von Wolke sieben" wie es Heinrich Prömpeler nennt. Und die derart hochgerüsteten Ärzte retten zwar einen weiteren "kleinen Prinzen", schaffen sich aber gleichzeitig oft ihr nächstes Sorgenkind.
Quelle: http://www.badische-zeitung.de/gesundheit-ernaehrung/die-kontrollierte-geburt--45052988.html
03.05.2011
Unerfüllter Kinderwunsch
Für viele Paare gehören eigene Kinder zu einer erfüllten Partnerschaft dazu. Doch was ist, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt? In Europa leiden statistisch gesehen etwa 15% der Paare unter einem unerfüllten Kinderwunsch. Nicht selten mündet dies für die Paare in einer Zerreißprobe. Bleibt der Kinderwunsch über Jahre hinweg unerfüllt, führen gegenseitige Schuldzuweisungen, schwindendes Selbstwertgefühl oder hoher Erfolgsdruck manchmal sogar zum Scheitern der Partnerschaft.
Welche Ursachen kann es für einen unerfüllten Kinderwunsch geben?
Bedeutet ein unerfüllter Kinderwunsch, dass man unfruchtbar ist?
Welche Ärzte helfen bei unerfülltem Kinderwunsch?
Welche Diagnosemöglichkeiten gibt es, der Ursache für den unerfüllten Kinderwunsch auf den Grund zu gehen?
Folgende Untersuchungsmethoden sind z. B. innerhalb des Stufenplans möglich:
- Körperliche Untersuchung: Wie der allgemeine körperliche Zustand des Paares?
- Ultraschall: Gibt es sichtbare Veränderungen der Organe, besonders der Fortpflanzungsorgane?
- Zyklustagebuch inklusive Messung der Basaltemperatur: Hat die Frau einen Eisprung? Gibt es Veränderungen in ihrem Zyklus?
- Untersuchung der Spermien: Wie hoch ist die Anzahl der Spermien? Wie sehen sie aus? Wie beweglich sind sie?
- Untersuchung der Hormone: Wie steht es um die Hormone, die an einer Schwangerschaft beteiligt sind? Sind Hormone für eine zu geringe Spermienqualität verantwortlich?
Unerfüllter Kinderwunsch – Was tun?
Folgende Behandlungsmethoden können z. B. bei einem unerfüllten Kinderwunsch zum Einsatz kommen:
- Hormonbehandlung: Mithilfe der Hormonbehandlung kann ein hormonelles Ungleichgewicht behoben werden. Darüber hinaus wird die Produktion von Eizellen angeregt.
- Insemination: Hat die Frau einen Eisprung, wird der Samen des Mannes auf künstlichem Wege eingebracht, um so eine Befruchtung des Eies zu erreichen. Ist die Samenqualität des Mannes nicht ausreichend, kann hier auch auf eine Samenspende zurückgegriffen werden.
- In-vitro-Fertilisation (IVF): Entnommene Eizellen der Frau und Samenzellen des Mannes werden in einem Reagenzglas zusammengebracht. War die Befruchtung erfolgreich, wird der Frau das befruchtete Ei in die Gebärmutter eingepflanzt.
- Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI): Hier wird die Samenzelle direkt in die Eizelle injiziert. So erhöhen sich die Chancen einer erfolgreichen Befruchtung deutlich. Das befruchtete Ei wird der Frau in die Gebärmutter eingepflanzt.
25.04.2011
Künstliche Befruchtung:
Viel zu viele Risikogeburten
 Die Fünflinge am Wiener AKH mussten in der 30. Schwangerschaftswoche geholt werden. Die Mädchen wogen 1.000 Gramm (rechts). Das türkische Paar hatte nach einer Hormonkur trotz „Verbots“ Geschlechtsverkehr. „Allah sollte entscheiden.“Die Geburt von Fünflingen im Wiener AKH am 18. März wurde als medizinische Sensation gefeiert. Ein 40-köpfiges Ärzte- und Schwesternteam holte fünf Mädchen wegen Herzproblemen der Mutter in der 30. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt. Die 1000-Gramm-Frühchen werden die nächsten zehn Wochen auf der Intensivstation der Wiener Neonatologie liegen müssen. Die hormonell stimulierte Mehrlingsschwangerschaft bei einer erst 26-jährigen Frau hat allerdings die Debatte um die Auswüchse der Reproduktionsmedizin angeheizt. Gynäkologen und Neonatologen fordern vehement gesetzliche Regeln und Sanktionen für die Babywunsch-Industrie. Frauen würden bis zu vier Embryonen eingepflanzt, die Folgen hätten die Kinder, die Spitäler und die Allgemeinheit zu tragen, so die Kritik an das Gesundheitsministerium. Dort arbeitet man bereits an neuen Richtlinien.
Die Fünflinge am Wiener AKH mussten in der 30. Schwangerschaftswoche geholt werden. Die Mädchen wogen 1.000 Gramm (rechts). Das türkische Paar hatte nach einer Hormonkur trotz „Verbots“ Geschlechtsverkehr. „Allah sollte entscheiden.“Die Geburt von Fünflingen im Wiener AKH am 18. März wurde als medizinische Sensation gefeiert. Ein 40-köpfiges Ärzte- und Schwesternteam holte fünf Mädchen wegen Herzproblemen der Mutter in der 30. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt auf die Welt. Die 1000-Gramm-Frühchen werden die nächsten zehn Wochen auf der Intensivstation der Wiener Neonatologie liegen müssen. Die hormonell stimulierte Mehrlingsschwangerschaft bei einer erst 26-jährigen Frau hat allerdings die Debatte um die Auswüchse der Reproduktionsmedizin angeheizt. Gynäkologen und Neonatologen fordern vehement gesetzliche Regeln und Sanktionen für die Babywunsch-Industrie. Frauen würden bis zu vier Embryonen eingepflanzt, die Folgen hätten die Kinder, die Spitäler und die Allgemeinheit zu tragen, so die Kritik an das Gesundheitsministerium. Dort arbeitet man bereits an neuen Richtlinien.Eizellen eingesetzt. Die komplizierten Fälle landen in den Spitälern. Dort wächst die Wut.
 AKH-Neonatologin Angelika Berger: „Wir sind nicht gegen die In-vitro-Technik. Viele Paare bekommen gesunde Kinder.“
AKH-Neonatologin Angelika Berger: „Wir sind nicht gegen die In-vitro-Technik. Viele Paare bekommen gesunde Kinder.“Wochen für Babys vor
„Eine Fünflingsschwangerschaft, die zweifellos durch fahrlässige Hormonstimulation ausgelöst wurde, ist kein Erfolg, sondern ein Versagen der Reproduktionsmedizin“, schrieb AKH-Frauenklinikchef Peter Husslein zornig an den zuständigen Sektionschef Gerhard Aigner im Gesundheitsministerium. Dort erarbeitet eine Arbeitsgruppe für den Obersten Sanitätsrat Empfehlungen für ein geändertes Fortpflanzungsmedizingesetz. „Wir haben kein Qualitätsmanagement der IVF-Medizin, das ist ein fürchterliches Manko“, urteilt die Vorsitzende des Arbeitskreises, die Salzburger Gynäkologin Barbara Maier.
Die IVF-Ethikerin hat eine Studie zur Problematik durchgeführt (siehe Kasten). Bei dem Gespräch mit dem SF stand Maier noch unter dem Eindruck einer typischen Frühgeburt: Zwillinge in der 25. Woche, eines der Kinder eine Querlage. Selbst im professionellen geburtshilflichen Kollektiv der Salzburger Klinik hat noch kein IVF-Zwilling unter der 27. Schwangerschaftswoche überlebt. Wer je gesehen hat, wie die zitternden, handgroßen Körperchen in den Brutkästen ums Leben kämpfen, weiß um die Tiefe und Dramatik dieser Vorgänge.
In der neonatologischen Intensivmedizin habe sich „sensationell viel getan“, erklärt Universitätsprofessorin Berger. Frühgeborene mit 1.000 Gramm hätten gute Chancen, ein völliger Irrglaube sei jedoch, dass alles möglich ist. Berger: „Bei den Allerkleinsten aus der 23., 24., 25. Schwangerschaftswoche mit weniger als 800 Gramm hat ein Drittel langfristige Probleme.“ Diese Kinder kommen häufiger ins Spital, haben respiratorische Probleme, Asthma oder andere Entwicklungsstörungen. Die Natur wisse sehr genau, warum ein Baby erst nach 40 Wochen reif ist, den Mutterleib zu verlassen, so die Neonatologin.
 Gynäkolgin und Medizinethikerin Barbara Maier: „Die Mehrlingsraten in Österreich sind im internationalen Vergleich viel zu hoch.“
Gynäkolgin und Medizinethikerin Barbara Maier: „Die Mehrlingsraten in Österreich sind im internationalen Vergleich viel zu hoch.“füllt die Spitäler
Und eben die Reproduktionsmediziner schlagen der Natur stolz ein Schnippchen. Die Babywunsch-Industrie füllt die Spitäler mit vielen, teilweise dramatisch verlaufenden Mehrlingsschwangerschaften. Die perinatalen Zentren sind randvoll, es besteht ein massiver Mangel an Intensivbetten. Die Frühchen werden sogar mit dem Hubschrauber zwischen den Kliniken hin- und hergeflogen. Auf den überlasteten neonatologischen und gynäkologischen Abteilungen macht sich Wut über die Auswüchse der IVF-Medizin breit. Besonders Wien ist belastet.
Außer den 20 Prozent langfristig unfruchtbaren Paaren kommen immer mehr blutjunge, oftmals ausländische Paare zur Fertilitätsbehandlung – 20-, 21-Jährige, die aus dem familiären Umfeld einem starken Druck ausgesetzt sind, Nachwuchs zu bekommen. 2009 gab es laut IVF-Fonds 23 Drillingschwangerschaften, 38 Frauen wurden sogar vier Embryonen eingesetzt.
„Es stört uns wahnsinnig, dass die Selbstbeschränkung der Institute nicht funktioniert“, sagt Wolfgang Arzt, Vorstand der Linzer Frauenklinik und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Prä- und Perinatal-Medizin. „Wir sind mit den Ergebnissen der IVF-Industrie konfrontiert. Wir müssen die Komplikationen und Pannen ausbaden und schauen, dass die Drillinge und Vierlinge überleben.“ Seine Fachgesellschaft fordere gesetzliche Regelungen, der singuläre Transfer müsse die Regel sein. Die Verpflanzung mehrerer Embryonen käme nur für ältere Frauen in Frage. „Das Ziel muss ein gesundes Kind sein.“
Man sei nicht prinzipiell gegen die In-vitro-Fertilisation, betont Neonatologin Berger. „Viele Paare bekommen gesunde Kinder und sind überglücklich.“ Dringend nötig sei aber eine Beschränkung der Zahl der transferierten Embryonen.
 Linzer Frauenklinikchef und Fachgruppenpräsident Wolfgang Arzt: „Wir müssen die Pannen ausbaden, wir fordern den Single-Embryo-Transfer.“
Linzer Frauenklinikchef und Fachgruppenpräsident Wolfgang Arzt: „Wir müssen die Pannen ausbaden, wir fordern den Single-Embryo-Transfer.“wird nun erhoben
Die aussagekräftige Baby-Take-Home-Rate müssen die 26 privaten und neun Krankenhaus-Institute erst seit Anfang 2010 erheben. Melden Eltern eine Geburt nicht, müssen sie die Förderung zurückzahlen.
2009 bezahlte der staatliche IVF-Fonds 6.600 Versuche (je 1.700 Euro an das Institut, 1.000 Euro zahlt das Paar). In Summe dürften es 10.000 Follikeltransfers gewesen sein, sagt Georg Freude, Gründer des Kinderwunschzentrums „Gynandron“ in Wien und Präsident der Österreichischen IVF-Gesellschaft. Die Vorwürfe der Perinatologen hält er für „emotionalisiert“. Er habe von dem Wiener Privatinstitut, aus dem die Fünflinge stammen, eine Rechtfertigung verlangt (dem SF gab das Institut keine Stellungnahme). Demnach wurde die 26-jährige Frau hormonell stimuliert, das Paar unterschrieb ein Kohabitationsverbot, deshalb könne man das Institut auch nicht klagen. Trotzdem kam es zum Geschlechtsverkehr, was der türkischstämmige Vater damit begründete, dass „Allah entscheiden“ sollte, „wann wir schwanger werden“. Die angebotene „Reduktion“ der Fünflinge wurde abgelehnt.
„Beim Fetozid handelt es sich um Töten“, erklärt Frauenklinikchef Husslein. „Man spritzt Kaliumchlorid in das Herz des Embryos und schaut, bis die Herzaktion aufhört. Dies geschieht in der 14. Schwangerschaftswoche, wenn die Föten einige Zentimeter groß sind.“ Der Vorgang sei für alle Beteiligten extrem belastend. Gynäkologe Wolfgang Arzt spricht sogar von „Wellness-Reduktionen“. „Finanziell gutgestellte Paare kommen und wollen Drillinge auf ein Kind reduzieren, weil drei Kinder ihnen zu viel Action sind.“ Diese Dinge seien der Grund, „warum es so nicht bleiben kann“, schreibt Husslein an das Ministerium. Sonja Wenger
 Süße Zwillinge: Jedes dritte Paar ist künstlich gezeugt.
Süße Zwillinge: Jedes dritte Paar ist künstlich gezeugt.Quelle: http://www.salzburger-fenster.at/redaktionell/2411-kuenstliche-befruchtung-brviel-zu-viele-risikogeburten-.html
18.04.2011
Fettleibigkeit macht Männer unfruchtbar
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-13285-2011-04-14.html
11.04.2011
Mehr als zwei sind ein großes Risiko
Fortpflanzungsmedizin: Die steigende Zahl von Mehrlingsgeburten sorgt für Diskussionen. Viele fordern strengere Regelungen.

Hormonstimulation
Dabei werden Medikamente verabreicht, die die Eizellreifung anregen und den Eisprung auslösen. "Viele Frauen sind aber überstimuliert", sagt Husslein: Es reifen zu viele Eizellen. Derzeit darf jeder Gynäkologe eine solche Stimulation durchführen. Husslein und die Arbeitsgruppe schlagen ein Zertifikat für die Hormonstimulation vor.
In-vitro-Fertilisation
Künstliche Befruchtung im Reagenzglas. Laut IVF-Fonds (er übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen 70 Prozent der Kosten) wurden 2009 bei den geförderten Befruchtungen in 505 Fällen drei Embryonen und in Privatkliniken bei 38 Frauen sogar vier Embryonen eingesetzt - letzteres widerspricht bereits den geltenden Empfehlungen auf der Homepage der Gesellschaft für Reproduktionsmedizin. Die von der Arbeitsgruppe aus Fortpflanzungsmedizinern und Geburtshelfern ausgearbeiteten neuen Empfehlungen sehen eine Einschränkung bei der Implantation von drei Embryonen vor. Univ.-Doz. Barbara Maier, Hauptautorin des Berichtes: "Drei Embryonen werden nur mehr dann empfohlen, wenn die Frau über 40 ist oder wenn sie schon drei oder vier IVF-Versuche hinter sich hat."
Gesetzliche Obergrenze
Maier und Husslein fordern, dass auch die privat gezahlten IVF-Zyklen genau dokumentiert werden müssen. Bei überdurchschnittlicher Zahl von Mehrlingsgeburten sollen die Institute kontrolliert werden. Husslein: "Die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist nur minimal größer, wenn man drei statt zwei Embryonen implantiert. Aber das Risiko, Mehrlinge zu bekommen, ist dramatisch erhöht."
Eine gesetzliche Obergrenze für die Zahl der eingesetzten Embryonen fordert die Gesundheitssprecherin der Wiener Grünen, Sigrid Pilz. "In Schweden darf nur ein Embryo eingesetzt werden. Die Zahl der Babys ist nicht signifikant geringer - aber die Kinder sind dafür gesünder."
"Ich bin grundsätzlich gegen eine gesetzliche Regelung", sagt hingegen Fortpflanzungsmediziner Univ.-Prof. Wilfried Feichtinger vom Wunschbaby-Zentrum. "Das Verantwortungsbewusstsein bei den guten Zentren ist durchaus gut." Der internationale Trend gehe zum Single Embryo Transfer - der ist vor allem für jüngere Frauen bis 35 gut, die unter keinen Umständen Zwillinge wollen. "Viele Mehrlingsschwangerschaften gehen nicht gut. In unseren Kreisen ist das ethisch verwerflich. In den meisten Fällen werden nicht mehr als zwei Eizellen eingesetzt."
Gute Zentren mit guten Einfrierprogrammen für befruchtete Embryonen haben mehr Möglichkeiten, sagt Feichtinger: "Zentren, die das nicht haben, sind eher bemüht auf Teufel komm raus Schwangerschaften zu erreichen."
Streit um Mehrlingsschwangerschaften
Nahezu alle unserer höhergradigen Mehrlinge kommen von einem Institut", sagt Univ.-Prof. Peter Husslein von der MedUni Wien - gemeint ist die Privatklinik Währing. "Es ist völliger Unsinn zu behaupten, dass Drillinge kein Problem sind. Bei Drillingen sterben 40 Prozent aller Kinder oder sind behindert." Husslein bezieht sich auf ein Interview von IVF-Mediziner Mohamed Zaghlula von der Privatklinik Währing in der ORF-Sendung Thema .
Es sei inakzeptabel, dass die Gesellschaft für die Folgen, die dadurch entstehen, aufkommen müsse. "Erst dieser Tage haben wir eine Sechslingsschwangerschaft aus diesem Institut auf Zwillinge reduzieren müssen."
Prof. Peter Hernuss, Leiter der betroffenen Klinik verteidigt sich: "Wir haben immer die Empfehlungen der Fachgesellschaften beachtet. Wir haben gleich viele oder sogar weniger Drillinge wie die anderen. Die Vorwürfe entstehen aus reinem Neid, weil wir mit gleich vielen eingesetzten Embryonen doppelt so viele Schwangerschaften haben wie die anderen."
30.03.2011
| Erste Spermien aus dem Reagenzglas | |||
| Erstmals Spermienreifung von Säugetieren außerhalb des Körpers | |||
Zum ersten Mal haben Wissenschaftler Säugetier-Spermien außerhalb des Körpers reifen lassen. Dies könnte einen wichtigen Durchbruch für die Behandlung männlicher Unfruchtbarkeit bedeuten. Mit Hilfe einer speziellen Kulturmethode gelang es dem japanischen Forscherteam, den vielschrittigen und komplexen Prozess von den Vorläufer-Stammzellen zu fertigen Mäuse-Spermien in vitro durchzuführen. Wie sie in „Nature“ berichten, produzierten Mäuseweibchen, die mit diesen Spermien befruchtet wurden, gesunden, fruchtbaren Nachwuchs.
Doch bisher ist die in vitro-Reifung der Spermien nur bei einigen wenigen Fischarten gelungen, noch nie jedoch bei einem Säugetier. Einem Forscherteam um Takehiko Ogawa und Takuya Sato von der Yokohama City Universität in Japan ist hier nun jedoch ein entscheidender Durchbruch gelungen: Sie entwickelten ein Kultursystem, in dem Spermatogonien von Mäusen bis zu fertigen Spermien reiften. Mäuseweibchen, die mit diesen Spermien befruchtet wurden, produzierten gesunden, fruchtbaren Nachwuchs. Hodengewebe in Nährlösung Um die optimale Umgebung für die Spermienreifung zu erstellen, hatten sich die Forscher eng an der natürlichen Zusammensetzung der Mikroumwelt im männlichen Hoden orientiert. Für ihre Kulturmethode nutzten sie Fragmente von unreifen Mäusehoden auf einem halbfesten Untergrund ähnlich der Agarose und umspülten dies mit flüssiger Nährlösung. Nach verschiedenen Tests der Temperaturen und der besten chemischen Zusammensetzung der Lösung zeigte sich unter anderem, dass fetales Rinderserum einer der unverzichtbaren Ingredienzen für die Kultur zu sein scheint. Fehlte diese Komponente, zeigte sich kaum Reifung der Spermienvorläuferzellen. „Unser Organ-Kultursystem konnte die Spermatogenese für mehr als zwei Monate anstoßen und aufrechterhalten”, erklären die Forscher in „Nature”. Das Hodengewebe mit den reifenden Spermien ließ sich sogar in flüssigem Stickstoff einfrieren und konnte mehrere Wochen später aufgetaut und erfolgreich eingesetzt werden. Hoffnung für unfruchtbare Männer? Gelingt nun die Übertragung dieser Methodik von der Maus auch auf menschliche Gewebe und Zellen, dann könnte dies eine große Hoffnung für unfruchtbare Männer bedeuten, insbesondere für Fälle, in denen sich Männer einer unfruchtbar machenden Chemie- oder Strahlentherapie unterziehen müssen. In Zukunft könnten sie sich vor der Behandlung Teile des Hodengewebes entnehmen und bei Kinderwunsch später Spermien in vitro erzeugen lassen. Noch ist das alles aber Zukunftsmusik, denn viele Fragen sind noch offen. So ist noch nicht klar, welche externen Signale genau für die Spermienreifung benötigt werden und wie sie wirken. Außerdem haben die Wissenschaftler zwar festgestellt, dass die mit Hilfe solcher in vitro-Spermien gezeugten Nachkommen fruchtbar sind, in wieweit sie aber vielleicht doch nicht auf Anhieb sichtbare Erbfehler oder sonstige Gesundheitsschäden mit sich tragen, muss noch geklärt werden. Homepage: |
23.03.2011
Das Schwinden der Fruchtbarkeit
In der Fachzeitschrift International Journal of Andrology berichten gerade finnische Wissenschaftler, dass in ihrem einst sehr naturbelassenen Heimatland mit dem Einzug der Industrie in die Städte die Fruchtbarkeit der männlichen Bevölkerung gelitten habe. Allein zwischen 1979 und 1987 sei die Zahl der Spermien im Ejakulat der beobachteten Männer um 30 Prozent gesunken. Noch stehe die Fruchtbarkeit finnischer Männer nicht infrage, zitiert das Deutsche Ärzteblatt den Forscher. Aber es seien weitere Untersuchungen notwendig, um die möglicherweise verantwortlichen Chemikalien zu identifizieren.
Allerdings sind die Fakten immer noch nicht ganz eindeutig. Von rund 100 000 Chemikalien wirken nach einer vorläufigen Einschätzung der Europäischen Kommission 299 wie Hormone. Darunter sind Pestizide, kosmetische Wirkstoffe und Substanzen für Kunststoffe. Sie werden endokrine Disruptoren genannt, wobei das Englische "disrupt" auf die Störung des Hormonsystems hinweist. Dazu gehören Chemikalien, die an den Östrogenrezeptor in den Zellen binden wie Bisphenol A und Weichmacher aus der Klasse der Phthalate. Aber auch Dioxine und Schwermetalle zählen dazu.
Bisher wurden viele endokrine Disruptoren zufällig entdeckt. Die hormonelle Wirkung wurde bei der Zulassung von Chemikalien bisher nicht gezielt abgefragt. Sie ergab sich als Nebenbefund oder aus Umweltbeobachtungen: Schiffsanstriche mit Tributylzinn ließen Meeresschnecken, Seesterne und Ruderfußkrebse verweiblichen. Männliche Alligatoren verschwanden in nur vier Jahren fast vollständig aus dem Apokasee in Florida, was auf Pestizide wie DDT und Dicofol zurückgeführt wurde. Fischotter und Nerze bringen bei hoher Belastung mit polychlorierten Biphenylen weniger Junge zur Welt.
All das lässt nichts Gutes für den Menschen erahnen. Der Chemiker Wolfgang Schäfer von der Uniklinik Freiburg warnt jedoch vor voreiligen Schlüssen: "Der menschliche Reproduktionszyklus unterscheidet sich grundlegend vom Tier und ist nur bei wenigen Affenarten vergleichbar", sagt er. "Deshalb eignen sich vor allem Tests an menschlichen Zellen, die hormonelle Wirkung von Chemikalien aufzudecken." Schäfer verwendet Zellen der Gebärmutterschleimhaut. Die meisten Hormongifte wirken auf die Zellen verweiblichend. Sie verstärken die Wirkung weiblicher Östrogene oder unterdrücken die männlichen Androgene.
In jüngster Zeit entdecken Forscher aber auch mehr und mehr Chemikalien, die zudem das Progesteron hemmen, ein Hormon, das die Schwangerschaft aufrechterhält. Mit dazu zählen Bisphenol A, ein Rohstoff für die Kunststoffproduktion, und der in Sonnencremes verwendete Ultraviolettfilter Benzylidencamphor.
"Diese Substanzen haben dann eine empfängnisverhütende Wirkung", erläutert Schäfer. "Die Wirkung der Chemikalien ist aber recht schwach im Vergleich zu körpereigenen Hormonen oder Arzneimitteln wie der Antibabypille oder dem Brustkrebsmedikament Tamoxifen. Der Mensch ist diesen Substanzen nur in Spuren ausgesetzt." Nur Bevölkerungsstudien können klären, ob unsere Fruchtbarkeit trotz der geringen Mengen beeinträchtigt wird.
Aber auch solche Studien gibt es bereits: "Was wir wissen, ist, dass Bisphenol A und Phthalate die Spermienqualität beispielsweise von chinesischen Arbeitern vermindert haben, die damit in Kontakt gekommen sind", sagt die Berliner Toxikologin Schönfelder. Shanna Swan von der University of Rochester im Bundesstaat New York beschrieb als eine der Ersten das Phthalatsyndrom: Jungen, deren Mütter viel Phthalat im Urin hatten, hatten einen kleineren Penis und Hodensack als gleichaltrige Kinder. Weil andere Studien dieses Ergebnis nicht bestätigen konnten, sollte man allerdings noch misstrauisch sein, noch hat es für den Wissenschaftler keine Gültigkeit.
Solche Widersprüche sind allerdings symptomatisch für Studien zu Hormonchemikalien. "Wir wissen einfach noch nicht, ob die Fruchtbarkeit der Normalbevölkerung – also nicht der hochbelasteten chinesischen Arbeiter in der Plastikfabrik – durch die Umweltchemikalien beeinträchtigt wird", sagt Schönfelder. Belegt ist dagegen, dass es um die Fruchtbarkeit in modernen Zivilisationen nicht zum Besten steht. Jedes sechste Paar in Deutschland hat Schwierigkeiten, Nachwuchs zu zeugen. Bei vielen kann die Ursache nie geklärt werden.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO senkte jüngst die Schwellwerte, anhand derer die Spermienqualität eingestuft wird. Zuvor mussten mindestens 30 Prozent der Spermien Normform – einen runden Kopf und ein bewegliches Schwänzchen – haben. Jetzt genügen vier Prozent.
Niels Skakkebaek von der Uni Kopenhagen rekonstruierte, dass sich die Zahl der Spermien von 1940 bis 1992 in Dänemark halbiert hat. Ein Fünftel der jungen Dänen haben heutzutage so wenig gesunde Keimzellen, dass sie als unfruchtbar gelten.
In Deutschland raffte man sich 2004 nur zu einer einmaligen Bestandsaufnahme auf. Ärzte baten 791 junge Männer aus Hamburg und Leipzig um eine Samenspende und fanden im Schnitt 42 Millionen Spermien je Milliliter. Schon unterhalb von 55 Millionen kann es mit dem Nachwuchs mühsam werden.
Deshalb warnt die Andrologin Andrea Salzbrunn vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, die an der Studie beteiligt war: "Ein großer Teil der jungen deutschen Männer scheint eine beeinträchtigte Samenqualität zu haben, die ihre natürliche Fruchtbarkeit herabsetzt." Warum, kann sie nicht sagen. Nur eine Ursache schälte sich deutlich heraus: Wenn die Mutter während der Schwangerschaft rauchte, sank die Spermienzahl ihres Sohnes um ein Viertel. "Es gibt bisher keine klaren Beweise, dass Schadstoffe an der Unfruchtbarkeit schuld sind", resümiert Rolf Kreienberg, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das Berliner Bundesinstitut für Risikobewertung vertritt denselben Standpunkt. Eine zweite Untersuchung ist bis heute nicht geplant.
Salzbrunn kommentiert das ganz unaufgeregt: "Die Erhebung hat 300 000 Euro gekostet. Das Geld ist nicht noch einmal da. Es gibt eben keine Fruchtbarkeitslobby." Im Gegenteil: Wenn Frauen schwanger werden wollen, verdient eine florierende Reproduktionsindustrie.
16.03.2011
EREKTIONSSTÖRUNG
Diese Medikamente machen impotent

08.03.2011
Gero Beckmann beweist im Labor Wirkung von Naturheilkunde
02.03.2011
Unfruchtbarkeit - Ursachen für eine Sterilität bei der Frau
 Unfruchtbarkeit muss kein unabdingbares Schicksal sein. Es gibt Ursachen für eine Sterilität, die sich im Laufe der Zeit von alleine regeln. Wenn die Fruchtbarkeit durch bestimmte Faktoren beeinträchtigt ist, können Medikamente oder eine Operation doch noch zum Wunschkind verhelfen. Welche Ursachen gibt es für die Unfruchtbarkeit bei Frauen?
Unfruchtbarkeit muss kein unabdingbares Schicksal sein. Es gibt Ursachen für eine Sterilität, die sich im Laufe der Zeit von alleine regeln. Wenn die Fruchtbarkeit durch bestimmte Faktoren beeinträchtigt ist, können Medikamente oder eine Operation doch noch zum Wunschkind verhelfen. Welche Ursachen gibt es für die Unfruchtbarkeit bei Frauen?
22.02.2011
Reproduktionsmedizin
Das Wunschkind
Viele Paare können Nachwuchs nur auf künstlichem Wege bekommen. Das bringt viele Probleme mit sich.Abhilfe verspricht die Reproduktionsmedizin mit ihren „Kinderwunschpraxen“. Eine wesentliche Therapie ist die künstliche Befruchtung, die In-Vitro-Fertilisation (IVF).
Mit dem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Chromosomenschäden. Hinzu kommen mögliche erbliche Vorbelastungen der Paare. Diese Faktoren haben die Aufmerksamkeit wieder stärker auf die Präimplantationsdiagnostik (PID) gelenkt, die Möglichkeit, Embryonen frühzeitig genetisch zu untersuchen, um Schwangerschaften mit erkrankten Embryonen auszuschließen.
Derzeit diskutiert der Bundestag, wie mit der PID künftig umgegangen werden soll. Die Rechtslage ist nicht eindeutig. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte im vergangenen Sommer klargestellt, dass eine PID grundsätzlich erlaubt sein soll, wenn mit ihr „schwere genetische Schäden“ am später im Mutterleib heranwachsenden Embryo vermieden werden können. Was das im Einzelnen bedeutet, bleibt derzeit den Medizinern und den sie beauftragenden Paaren überlassen. Der BGH hat nur, allerdings eher am Rande, festgestellt, dass er das Embryonen-„Screening“, also eine morphologische Untersuchung unter dem Lichtmikroskop, zur Auslese ablehnt. Damit könnte beispielsweise ermittelt werden, welche der befruchteten Eizellen für die Einnistung in der Gebärmutter besonders geeignet erscheint. Einer weiteren Ausdehnung der PID, etwa durch Herstellen einer Vielzahl von Embryonen, sind nach Meinung von Juristen durch das Embryonenschutzgesetz Grenzen gezogen.
Ob die PID angeboten wird, lässt sich in den Praxen erfragen. Die Kosten hängen von der Störung ab, die diagnostiziert werden soll. Als grobe Richtschnur gilt unter Medizinern ein Betrag um die 500 Euro pro Embryo. Eine IVF kostet pro Behandlungszyklus ungefähr 2000 Euro, die Krankenkasse übernimmt seit der Gesundheitsreform 2004 nur noch 50 Prozent – und dies auch nur, wenn die Paare verheiratet und nicht zu alt sind. Technisch gesehen hat die PID in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. In der Form der „Blastozystenbiopsie“ rund fünf Tage nach der Befruchtung werden dafür Zellen verwendet, die sich später im embryonalen Teil der Plazenta finden. Eine Schädigung des Embryos ist nahezu ausgeschlossen. Auch dies hat die Karlsruher Richter bewogen, das Embryonenschutzgesetz PID-freundlich auszulegen.
Wie lange die Periode relativer PID-Freiheit in Deutschland noch währt, ist ungewiss. Zwei der drei Gesetzentwürfe sehen eine restriktive Zulassung vor, einer, für den sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausgesprochen hat, ein Totalverbot. Die PID unterscheide zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben, lautet das Hauptargument. Wie der Bundestag sich entscheidet, ist ungewiss, es gibt keinen Fraktionszwang. Aber die Stimmen, die PID jedenfalls eingeschränkt zu erlauben, werden mehr.
Unabhängig davon sollte man sich im Klaren sein, dass die Reproduktionsmedizin Kinder nicht garantieren kann, schon gar keine gesunden. Die sogenannte Baby-take-home-Rate, also der Therapieerfolg, liegt in Deutschland zwar bei 15 Prozent und damit in der Nähe der Wahrscheinlichkeit bei spontaner Empfängnis. Das Risiko für Fehlbildungen ist nach solchen Behandlungen aber im Vergleich um 30 bis 40 Prozent erhöht. Auch besteht ein statistisch erhöhtes Risiko für Komplikationen rund um die Geburt selbst.
14.02.2011
Kinderwunsch als ehrgeiziges Projekt
08.02.2011
IN-VITRO-FERTILISATION
Grüne Pilz übt Kritik am Geschäft mit Kinderwunsch
Gesundheitssprecherin Sigrid Pilz fordert gesetzliche Obergrenze für Zahl der bei künstlicher Befruchtung eingesetzten Embryos
01.02.2011
Fortpflanzungsmedizin
Gefährliche Eizellspende
Die Inanspruchnahme einer Eizellspende zwecks künstlicher Befruchtung ist in Deutschland zwar verboten, aber trotzdem ist ärztliche Hilfe angesagt: Schwangeren drohen Krampfanfälle und Fehlgeburten.
Von Martina Lenzen-Schulte
26. Januar 2011
Die Eizellspende ist für viele unfruchtbare Paare die letzte Hoffnung, doch noch ein Kind zu zeugen. Sie ist zwar in Deutschland verboten, aber auch hier gibt es zahlreiche Mütter, die sich in Nachbarländern mit den Eizellen einer anderen Frau der künstlichen Befruchtung unterzogen haben. Ihnen gebührt dringend mehr ärztliche Aufmerksamkeit, denn eine so zustande gekommene Schwangerschaft ist risikobehaftet. Darauf macht Ulrich Pecks von der Universitätsfrauenklinik in Aachen in der jüngsten Ausgabe des „Deutschen Ärzteblattes“ aufmerksam (Bd. 108, S. 23).
In der Frauenklinik Aachen war man mit einer Serie von Fällen sogenannter Hypertensiver Schwangerschaftserkrankungen oder Präeklampsien konfrontiert gewesen, die überwiegend mit Frühgeburt und Mangelentwicklung des Kindes einhergingen. Bei drei schwerwiegenden Verläufen musste die Schwangerschaft wegen akuter Lebensgefahr für die Mutter vorzeitig beendet werden. Die Neugeborenen überlebten nicht.

Anzeige
Kindeswachstum verzögert
Da auffiel, dass diese Schwangerschaften häufiger als durch Zufall erklärbar auf eine Eizellspende zurückgingen, versuchten die Aachener Frauenärzte, mit Hilfe internationaler Untersuchungen die Risiken genauer zu beziffern. Bei der Hypertensiven Schwangerschaftserkrankung handelt es sich um ein Entgleisen mehrerer Systeme im Verlauf einer Schwangerschaft, die bei der Mutter mit erhöhtem Blutdruck, Wassereinlagerungen (Ödemen), übermäßigen Eiweißverlusten über die Niere und Neigung zu Krampfanfällen einhergehen.
Die Schwangerschaft selbst ist gefährdet, das Wachstum des Kindes zum Teil erheblich verzögert. Nach Eizellspende beträgt das Risiko hierfür je nach Studie 22 bis 28 Prozent. Manche Umstände verschlimmern die Prognose. Frauen, die Mehrlinge erwarten, sind beispielsweise doppelt so häufig betroffen wie jene, die nur ein Kind bekommen. Junge Frauen unter 35 sind überraschenderweise am meisten gefährdet, mehr sogar als solche über 40, während sonst eher ein höheres Alter mit Komplikationen bei der In-Vitro-Fertilisation behaftet ist. Gegenüber einer auf natürlichem Weg zustande gekommenen Schwangerschaft ist das Risiko für eine hypertensive Erkrankung nach einer Eizellspende mehr als sechseinhalb Mal so groß wie sonst.
Ärztliche Begleitung notwendig
Die Gründe hierfür kennt man noch nicht genau. Allerdings gibt es zahlreiche Hinweise, dass das Geschehen mit der mütterlichen Immunreaktion auf das fremde Gewebe zusammenhängt. Das Ungeborenes ist für die Schwangere ohnehin stets „halbfremd“ wegen der nicht verwandten Genausstattung durch den Vater. Dass es überhaupt gelingt, diesen Fremdkörper in so enger Verbindung zu dulden, ist ein nur in Ansätzen verstandenes Kunststück zum Teil unterdrückter Abwehrmechanismen. Hierbei kommt es insbesondere auf eine gelungene Kommunikation zwischen natürlichen Killerzellen der Mutter und des HLA-C Antigens des Feten an, das den immunologischen Fingerabdruck darstellt. Funktioniert die Interaktion nicht oder schlecht, bilden sich beispielsweise Blutgefäße im Mutterkuchen, durch die der Embryo ernährt wird, nicht regelrecht aus. Da eine zweite Schwangerschaft mit Eiern von derselben Spenderin oft günstiger verläuft, könnte man hierin eine Gewöhnung an den dann weniger fremden Embryo und damit eine Bestätigung dieser Hypothese vermuten.
Da somit bereits zu Beginn der Schwangerschaft immunologisch falsche Weichen gestellt werden, kommt einer konsequenten ärztlichen Begleitung von Anfang an große Bedeutung zu. Frauenärzte sollten daher, so betonte Pecks in einem Gespräch, nach den Umständen der Zeugung fragen und insbesondere konkret das Thema Eizellspende ansprechen. Für Deutschland schätzt man, dass Frauen im Ausland etwa 2000 Befruchtungszyklen vornehmen lassen, um mittels Eispende schwanger zu werden, woraus zwischen 400 und 500 Kinder hervorgehen. Das ist umso wichtiger, als die einschlägigen Internet-Seiten von Kliniken, die in den Nachbarländern ausdrücklich um deutsche Kunden werben, die Risiken nicht nennen.
Rechtliche Regelungen
Eine in Aachen betreute Patientin war zweimal mittels Eizellspende schwanger geworden. Beim ersten Mal hatte sie das Kind aufgrund einer Hypertensiven Schwangerschaftserkrankung verloren. Sie berichtete in Aachen, dass sie bei einem neuen Versuch wegen des vorausgegangenen dramatischen Verlaufs eigens nachgefragt hatte, man in der ausländischen Fertilitätsklinik aber eine besondere Präeklampsiegefahr verneint habe. Das ist umso weniger zu rechtfertigen, als unter Fachleuten entsprechende Hinweise schon seit 1980 immer wieder diskutiert wurden. Hinzu kommt, dass die Eizellspende weitere Gefahren für das Kind birgt. Um den Geburtstermin ist häufiger als sonst mit Blutungen zu rechnen, die Sterblichkeit der mittels Eizellspende gezeugten Kinder ist um ein Vielfaches höher als die von natürlich gezeugten Kindern.
Auch die Tatsache, dass wegen des rechtlichen Verbots eine Atmosphäre mangelnder Akzeptanz geschaffen wird, könnte laut Pecks die Frauen davon abhalten, von sich aus die Eizellspende anzusprechen. Insgesamt geht man mit der Eizellspende weniger offen um als etwa mit der Samenspende. Die Eizellspende ist auch in Norwegen, der Schweiz und der Türkei verboten, anonym wird sie in Dänemark, Frankreich, Spanien, Portugal und Slovenien vorgenommen. Offen praktiziert man sie in Großbritannien, Schweden und den Niederlanden, dort werden die Namen der Spenderinnen nicht geheim gehalten. Beruhigen kann man die werdenden Mütter dahingehend, dass ihnen das Kind nach der Eizellspende nicht streitig gemacht werden kann. Hierzulande gilt die Frau, die das Kind geboren hat, als leibliche Mutter.
Text: F.A.Z.
Bildmaterial: picture-alliance / dpa
Bildmaterial: picture-alliance / dpa
25.01.2011
KÜNSTLICHE BEFRUCHTUNG Das Milliardengeschäft mit dem Kinderwunsch
Nicht nur Nicole Kidman oder Elton John machen es: Millionen Paare verwirklichen ihren Traum vom eigenen Baby mit Hilfe von künstlicher Befruchtung oder sogar Leihmüttern. Die Reproduktionsindustrie verdient damit Milliarden. Das Geschäft mit dem menschlichen Embryo hat begonnen.
DÜSSELDORF. Die Natur gibt sich nicht kampflos geschlagen. Durch einen Saugmechanismus an der Flucht gehindert, dehnt sich die Eizelle bis zum Äußersten, um die winzige Spritze abzuwehren. Sie greift sogar zu einer List: Der Eindringling wähnt sich schon am Ziel, die Haut der Zelle scheint durchbrochen. Sie hat sich aber schlicht um die Spritze gelegt. Der Angreifer muss noch einmal ausholen, bis die Eizelle ihren Widerstand aufgibt – und das ihr aufgedrängte Spermium in sich aufnimmt.
Der Schöpfungsakt in der Petrischale, er ist vollbracht.
Ein Akt, der sich jeden Tag in den Laboren wiederholt. Wissenschaftler auf der ganzen Welt produzieren pro Jahr Hunderttausende menschliche Embryonen – und damit den Rohstoff für eine ganz spezielle Branche: die Industrie rund um das ungeborene Leben. Etwa vier Millionen Babys hat diese Industrie bereits zur Welt gebracht, seit Louise Brown am 25. Juli 1978 in Großbritannien geboren wurde – das erste künstlich gezeugte Kind. Allein in Deutschland waren es 2009 rund 8 000 Babys.
Kliniken, Labore und Pharmakonzerne setzen mit dem Elternglück viel Geld um, den US-Markt beziffern die Experten von Marketdata Enterprises auf etwa vier Milliarden Dollar. Es ist eine lukrative Industrie – viele Menschen sind bereit, für ihren Kinderwunsch jeden Betrag zu bezahlen, den sie aufbringen können. Und es ist eine stille Industrie: Kaum jemand, der ihre Dienste in Anspruch nimmt, spricht darüber. Nur ganz selten wird es laut, etwa wenn Prominente wie die Schauspielerin Nicole Kidman oder der 63-jährige Popstar Elton John mit ihren Babys vor die Kameras treten, die von Leihmüttern zur Welt gebracht wurden.
In Deutschland sind laut einer Studie rund 1,4 Millionen Paare ungewollt kinderlos
Die Angebotspalette der Branche reicht von der Befruchtung im Reagenzglas über die Eizellspende bis hin zur Leihmutterschaft. An Kundschaft mangelt es nicht: In Deutschland sind laut einer Studie rund 1,4 Millionen Paare ungewollt kinderlos. Viele von ihnen sind bereit, die finanziellen Belastungen einer künstlichen Befruchtung auf sich zu nehmen – und diese sind beträchtlich.
Rund 3 000 Euro kostet eine Behandlung, doch damit ist es oft nicht getan: Selbst bei jungen Frauen liegen die Erfolgschancen unter 40 Prozent, ab 35 Jahren sinken sie rasant weiter. Jan-Steffen Krüssel, Leiter des Kinderwunschzentrums der Uniklinik Düsseldorf, hat schon eine Patientin betreut, die nicht weniger als 16 Anläufe unternahm, bis sie ihr ersehntes Baby im Arm halten durfte.
Die Krankenkassen federn die Belastungen nur teilweise ab. Gesetzlich Versicherte bekommen seit der Gesundheitsreform im Jahr 2004 nicht mehr die vollen Kosten erstattet, sondern nur noch die Hälfte – und das auch nur bei den ersten drei Versuchen, und nur wenn das Paar verheiratet ist.
So summieren sich die Ausgaben in Deutschland zu einem einträglichen Geschäft. Die gesetzlichen Kassen bezahlten im Jahr 2008 rund 40 Millionen Euro für die Behandlungen, neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Der Vorsitzende des Verbandes der reproduktionsmedizinischen Zentren, Ulrich Hilland, schätzt das Marktvolumen inklusive der Eigenleistungen der gesetzlich Versicherten auf 100 Millionen Euro. Darin noch nicht eingerechnet sind die Privatpatienten, deren Ausgaben nicht erhoben werden.
Gut die Hälfte der Summe fließt an die Hersteller von Fruchtbarkeitsmedikamenten, allen voran den Darmstädter Dax-Konzern Merck. Das Unternehmen dominiert diesen Markt, den Experten auf gut eine Milliarde Euro schätzen. Den Rest der Einnahmen erhalten die Ärzte, laut Hilland bleiben im Durchschnitt rund 20 Prozent des Umsatzes bei den Medizinern hängen.
Die Industrie produziert Leben. Aber manchmal nimmt sie es auch. Wenn die Ärzte mehr Embryonen züchten, als für die künstliche Befruchtung einer Frau nötig ist, dann entscheiden sie zugleich über Leben und Tod der ungeborenen Kinder. Genau das ist der Fall bei der Präimplantationsdiagnostik (PID), die derzeit in Deutschland emotional diskutiert wird.
Und eben das ist der Grund, weshalb sich die Industrie heikleren Fragen stellen muss als jede andere – selbst als die Waffenindustrie. Wie stark darf der Mensch der Natur oder Gott in die Hand greifen? Hat ein nur Bruchteile eines Millimeters großer Zellklumpen die gleichen Rechte wie ein ausgewachsener Mensch? Welche Rolle, wenn überhaupt, dürfen wirtschaftliche Interessen bei solchen Erwägungen spielen?
Die Antworten, die ein Land auf diese Fragen gibt, sagen nicht nur viel über die jeweilige Gesellschaft aus. Sie entscheiden auch über Wohl und Wehe seiner Industrie rund um das ungeborene Leben.
Deutschland sei Weltmarktführer in Sachen Bioethik, sagte der US-Wissenschaftler James Thomson einst, die Vereinigten Staaten seien Weltmarktführer in der Biotechnologie. Tatsächlich setzt kaum ein Land der Industrie so enge Grenzen wie die Bundesrepublik. Für Embryonen gelten ab der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle die zentralen Menschenrechte des Grundgesetzes wie der Schutz der Menschenwürde und der Persönlichkeitsentfaltung. Die Folge: Eizellspende: verboten. Leihmutterschaft: de facto verboten. Präimplantationsdiagnostik: unklar, Bundeskanzlerin Angela Merkel plädiert aber für ein Verbot.
Während Deutschland darüber diskutiert, ob das Verfahren für schwere genetisch bedingte Krankheiten zugelassen werden soll, sind die Mediziner in den USA deutlich großzügiger: Die Auswahl des Geschlechts per Präimplantationsdiagnostik gehört bereits zum Standardrepertoire vieler US-Kliniken. Die Kunden reisen zu Tausenden aus aller Welt an. Chinesen und Inder bestellen fast immer Jungen, Europäer und Nordamerikaner meistens Mädchen. Die Gesetzgebung in vielen amerikanischen Bundesstaaten ist lax – oder sie existiert gar nicht erst.
In Los Angeles etwa wirbt der Klinikchef Jeffrey Steinberg damit, per Präimplantationsdiagnostik das gewünschte Geschlecht zu liefern – „mit 99-prozentiger Sicherheit“. Kostenpunkt: 18490 Dollar, die Befruchtung der Frau inklusive. Vor zwei Jahren kündigte Steinberg an, dass die Eltern auch noch die Farbe von Haaren und Augen frei wählen könnten. Die Interessenten standen bereits Schlange, nach öffentlicher Entrüstung zog er das Angebot aber zurück. Die Zeit dafür sei nicht reif, sagte er. Noch nicht.
Finden die Ärzte Hinweise auf Erbkrankheiten, wird der Embryo „verworfen“
Angesichts solcher Praktiken fühlen sich in Deutschland nicht nur die Gegner des Verfahrens an Aldous Huxleys Horrorvision aus dem Roman „Schöne neue Welt“ erinnert, in der die Embryonen entsprechend ihrer Kaste geprägt werden. Die Kritik an der Präimplantationsdiagnostik entzündet sich daran, dass sie Ärzten und Eltern erlaubt, eine Selektion vorzunehmen. Die künstlich gezeugten Embryonen werden vor der Einführung in den Mutterleib auf Erbkrankheiten untersucht; werden die Ärzte fündig, wird der Embryo „verworfen“, wie es in der Fachsprache heißt.
Andere sprechen dagegen von Töten. Der Kölner Erzbischof Kardinal Meisner etwa verglich die Präimplantationsdiagnostik mit dem Kindermord von Bethlehem – auch König Herodes habe eine Selektion vorgenommen. Die Befürworter halten dagegen: Durch das Verfahren werde den Kindern das Leid erspart, todkrank zur Welt zu kommen; und damit auch unzumutbare Belastungen der Eltern vermieden.
Das bislang geltende, strikte Verbot hat zudem unerwünschte Nebenwirkungen: Deutsche Paare reisen ins Ausland, um dort eine Präimplantationsdiagnostik durchführen zu lassen. Besonders Belgien hat sich zum Ziel entwickelt, denn dort wird das Verfahren überhaupt nicht gesetzlich reglementiert.
Auch Paare, die eine Eizellspenderin oder eine Leihmutter suchen, weichen in Staaten mit weniger strengen Gesetzen aus. Jan-Steffen Krüssel, der auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin ist, schätzt ihre Zahl auf etwa 5000 pro Jahr. In Spanien, wo die Spende von Eizellen erlaubt ist, stellten die Zentren deshalb sogar bereits deutschsprachiges Personal ein.
Auch ukrainische und amerikanische Kliniken werben im Internet gezielt um zahlungskräftige Kundschaft aus Deutschland und anderen Verbotsländern wie etwa Frankreich. Eine der größten Spezialkliniken steht in der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine: „Das Internationale Zentrum der Leihmutterschaft gibt eine Datenbank Leihmütter, die Informationen über die Kandidaten Leihmütter oder Eizellspenderinnen (Fotos und allgemeine Informationen) enthält“, heißt es in holprigem Deutsch auf der Homepage der Klinik. Der Paketpreis für die Vermittlung und Betreuung einer Leihmutterschaft liegt bei mehr als 20 000 Euro.
Die ukrainischen Frauen, die sich dafür zur Verfügung stellen, bekommen davon gerade einmal 1 000 Euro plus Zuschüsse für Nahrung oder Schwangerschaftskleidung. Laut Krüssel nehmen die Ärzte in derartigen Kliniken nicht immer Rücksicht auf die Gesundheit der Frauen. Es komme immer wieder vor, dass ihnen zu viele Hormone verabreicht würden, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen.
Die Industrie für das ungeborene Leben nutzt also nicht nur den technischen Fortschritt, bisweilen nutzt sie auch die Armut der Lebenden.
Quelle: http://www.handelsblatt.com/technologie/medizin/kuenstliche-befruchtung-das-milliardengeschaeft-mit-dem-kinderwunsch;2735447
17.01.2011
Frühchen - Deutschland sieht alt aus
Frühchen bringen kaum Gewicht auf die Waage, verursachen aber immense Kosten. Wem Monate der Reifung im Mutterleib fehlen, der hat nicht nur ein hohes Sterberisiko, sondern lebt auch später oft mit einem Entwicklungs-Handikap. Deutschland liegt einer Studie zufolge nicht nur bei der Versorgung der empfindlichen Wesen weit hinter anderen europäischen Staaten, sondern auch bei der Prävention von Frühgeburten.
Sie wiegen oft nicht einmal ein halbes Kilo und sind die empfindlichsten Patienten, um die sich die Medizin kümmern muss. Bei ihnen vergehen nur fünf bis sechs Monate zwischen der Teilung der befruchteten Keimzelle und dem Start ins Leben ausserhalb der geschützten mütterlichen Entwicklungshöhle. Eigentlich wären mindestens drei Monate länger nötig, um nicht gleich nach der Geburt auf der Intensivstation zu landen. Und doch nimmt die Zahl der Frühgeburten immer mehr zu. Deutschland und sein Nachbar Österreich nehmen dabei im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz ein. Das zumindest sagt ein Bericht der „European Foundation for the Care of Newborn Infants“ (EFCNI), der vor einigen Monaten erschien.
Frühchen
Nur zwei von drei überleben
Bei jeder elften Geburt in Deutschland kommt das Kind unreif zur Welt. Dabei lassen sich durch Aufklärung und Präventionsmaßnahmen viele dieser unerwünschten Ereignisse verhindern. Aber in Deutschland hapert es nicht nur bei der Früherkennung von Risikoschwangerschaften, sondern auch bei der Nachsorge: „In Deutschland benötigen wir dringend eine verbesserte psychosoziale Unterstützung der Eltern im Krankenhaus sowie ein strukturiertes und flächendeckendes Nachsorgeprogramm“, forderte Silke Mader von der EFCNI auf einer Pressekonferenz zum „Tag der Frühgeborenen“, am 17. November letzten Jahres. In der ZEIT beschreibt Anita Stacha, welche Konsequenzen die fehlende Zeit in der Gebärmutter haben kann: Operation wegen eines Leistenbruchs nach acht Wochen, Augenprobleme und Gehirnblutung. Danach ständige Überwachung der Atmung und mehrmalige Wiederbelebung, Lungenentzündung und Entwicklungsstörungen. Während die Sterblichkeit unter Neugeborenen bei rund drei von Tausend liegt, bewegt sie sich bei Frühchen vor der 26. Schwangerschaftswoche im Hundertfachen.
Restriktives Kinderwunsch-Programm
Jedes Kind, das vor der 37. Woche - mehr als drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin - zur Welt kommt, ist ein Frühchen. Unter 13 europäischen Ländern schwankt die Rate beträchtlich. Im Vergleichsjahr 2004 betrug sie etwa in Schweden und Frankreich sechs Prozent, in Deutschland rund neun Prozent und in Österreich elf Prozent. Wer sich die Daten genau ansieht, dem fällt auf, dass die Häufigkeit in den Ländern am niedrigsten ist, die über strukturierte Programme zur Versorgung der Schwangeren verfügen. Schweden hat etwa einen breiten Zugang zur Schwangeren-Vorsorge geschaffen. Strenge Auflagen bei der Behandlung von Frauen mit bisher unerfülltem Kinderwunsch und zentralisierte Intensivstationen für Neugeborene sorgen für den Spitzenplatz in der Statistik.
Risiko-Frühchen in Zentren mit Erfahrung
©
Wie kommt es zur Frühgeburt? Etwa die Hälfte aller vorzeitigen Entbindungen gehen auf Infektionen der Scheide zurück. Daneben tragen aber auch Faktoren wie Rauchen, Stress, falsche Ernährung, das Alter der Schwangeren oder auch Fruchtbarkeitsbehandlungen mit häufigen Mehrlingsgeburten zum höheren Risiko bei. Für einen großen Teil des überraschenden Sprungs der Fruchtblase haben auch Experten keine Erklärung. Umso wichtiger erscheint es den Autoren des Reports, Risiken zu erkennen und in den Griff zu bekommen. Infektionen der Scheide zeigen sich etwa im pH-Wert am Eingang an, ein Parameter, der für die Frau leicht selbst zu messen ist. Dazu soll ein Beratungsgespräch mit der werdenden Mutter anleiten. Am besten zusammen mit einem Ernährungsberater, der über die Ernährungsbedürfnisse von Mutter und ungeborenem Kind aufklärt.
Seit etwa zehn Jahren versucht dies in Deutschland das Programm „BabyCare“. Dass ein solches Konzept die Frühgeburtenrate senkt, konnten Studien bereits zeigen, in die allgemeine Schwangeren-Vorsorge sind BabyCare oder ähnliche Modelle deswegen noch lange nicht integriert. Aber auch wenn der Winzling den Bauch der Mutter verlassen hat, gibt es gerade in Deutschland noch große Defizite - trotz der Reformen bei der Frühgeburten-Versorgung seit einem halben Jahr. Der Gemeinsame Bundesausschuss beschloss im Frühsommer, dass nur spezielle Geburtszentren mit einer Fallzahl von mindestens 30 pro Jahr Frühchen mit einem Geburtsgewicht unter 1250 Gramm versorgen dürfen. „Die medizinische Betreuung von Frühgeborenen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die ein geeignetes stationäres Umfeld mit einer spezialisierten und gut ausgebildeten Belegschaft erfordert“, begründet Christian Poets von der Uniklinik in Tübingen die neuen Bestimmungen.
Versorgungsempfehlungen bleiben in der Schublade
Dennoch bewegt sich nur langsam etwas bei der Fürsorge für ganz kleine Patienten und deren Angehörige in Deutschland. Erst seit Kurzem erstatten Kassen Nachsorgemaßnahmen wie etwa die psychische Betreuung von Eltern, langfristige Therapiemassnahmen für ihr Kind oder die Unterstützung für Geschwister. Je höher die Rate an Frühgeburten, desto mehr geht die Nachsorge ins Geld. Nach Schätzungen von BabyCare sind es etwa 500 Millionen Euro im Jahr in Deutschland, die Zusatzkosten gegenüber einer „normalen“ Geburt betragen ohne die langfristige Nachsorge allein schon 10.555 Euro.
Allzu viel Hoffnung, dass sich an der Situation schnell etwas ändert, gibt der Report nicht. Richtlinien für die Ärzte auf den Geburtsstationen gibt es: Etwa die von „NIDCAP“ (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), ein Konzept für die Frühversorgung. „Es gibt kein Krankenhaus, das nach den Richtlinien von NIDCAP arbeitet. Es fehlen dort die Kapazitäten zur Schulung des Personals und zur Umstellung der täglichen Abläufe“, schildert Silke Mader die Bedingungen in deutschen Geburtskliniken.
Weltweit sterben rund 450 neugeborene Kinder pro Stunde. In Europa etwa jedes hundertste. Die ersten Stunden nach der Geburt sind für Kinder unter fünf Jahren die riskantesten ihres Lebens. „Tausende von Todesfällen im Kindesalter, chronische Leiden und andere Beschwerden, die auf eine zu frühe Geburt zurückgehen, ließen sich durch eine verbesserte neonatale Prävention, Behandlung und Fürsorge vermeiden“, so schreiben die Autoren des Berichts „Too little, too late? - Why Europe should do more for preterm infants“. Das Thema ist zu wichtig, um im Aktenordner abgeheftet zu werden.
Quelle: http://news.doccheck.com/de/article/202604-fruehchen-deutschland-sieht-alt-aus/
11.01.2011
Kinderwunsch – und dann die Realität
Die Österreicher wollen mehr Kinder, als sie dann tatsächlich haben. Die Überlegungen der Frauen und Männer bezüglich ihres Nachwuchses sind dabei höchst unterschiedlich, wie ein EU-Forschungsprojekt zeigt.
Mittelstand, arm oder reich, mit oder ohne religiöses Bekenntnis, mit niedrigem oder hohem Bildungsgrad und natürlich, ob der Mann oder die Frau in der Partnerschaft oder Ehe dominiert: Das sind die Komponenten, die bestimmend sind für die Anzahl der Kinder und damit für Einrichtungen wie Kindergarten und Schule, für Berufe wie Lehrer und Jugendbetreuer und letztlich für das Auf und Ab der Bevölkerungszahl eines Staates. Der signifikante Rückgang der Geburtenzahlen in Europa ist zu einem der beherrschenden Themen der Demografie geworden. „Sozialpsychologische Untersuchungen des geplanten Verhaltens von Männern und Frauen helfen uns, Kinderwünsche zu verstehen und Maßnahmen, die zu ihrer Verwirklichung beitragen, zu identifizieren“, sagt Dimiter Philipov vom Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
In Wien wird das EU-weite Projekt „Repro“ (Reproduktive Entscheidungsfindung) koordiniert und für die Periode 2008 bis 2011 über das siebte EU-Forschungsrahmenprogramm finanziert. Hauptaufgabe der Forschungsprojekte ist die Offenlegung der Hintergründe des Geburtenrückgangs. Alarmiert wurden die EU-Strategen durch die Fertilitätszahlen. Nach den statistischen Erhebungen liegen sie im EU-Durchschnitt für 2008 bei 1,60 Kindern pro Frau (2006 noch 1,72), wobei Irland mit 2,1 an der Spitze liegt, gefolgt von Frankreich mit 1,99. Großbritannien mit 1,96 und Schweden mit 1,91 verzeichnen noch respektable Werte, dann aber sacken die Zahlen ab. Deutschland wird mit 1,38 ausgewiesen, Österreich mit 1,41. Verglichen zum Nachkriegsmaximum in Österreich im Jahr 1963 mit 2,82 bekommen die Frauen hierzulande nur noch halb so viele Kinder. Derzeit ist in vielen europäischen Ländern ein moderater Aufschwung zu beobachten, von dem jedoch u.a. Deutschland und Österreich ausgenommen sind. Den höchsten europäischen Wert verzeichnet das Nicht-EU-Land Island mit 2,15.
„Repro“ vergleicht mehrere europäische Länder und geht von einer Makro- und einer Mikroperspektive aus, sagt Projektleiter Philipov. Erstere betrifft die vor allem vom Staat vorgegebenen Bedingungen wie die Familien- und Kinderhilfe oder die Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen. Wichtig ist des Weiteren die wirtschaftliche Situation. Analysen für OECD-Länder zeigen, dass mit steigendem Bruttoinlandsprodukt die Fertilitätsraten fallen, jedoch ab 10.000 Euro pro Kopf wieder steigen.
Die Mikroebene trifft Aussagen über die Einstellungen der Männer und Frauen, wobei die Erhebungen die Altersgruppe von 18 bis 45 Jahren umfassen. In Österreich wurden 2009 die ersten grundlegenden Daten von der Statistik Austria erhoben („Familienentwicklung in Österreich“, siehe Artikel auf Seite 23). Befragt wurden flächendeckend rund 3000 Frauen und 2000 Männer, womit sich das Gesamtbild nach mehreren Faktoren aufgliedern lässt und vor allem soziale Unterschiede sowie der Konflikt zwischen Beruf und Familie sichtbar werden.
Bei vielen Detailfragen zeigt sich der unterschiedliche Kinderwunsch von Frauen und Männern. In der Gruppe der Unter-30-Jährigen wollen Frauen im Durchschnitt zwei Kinder, während der Kinderwunsch von Männern etwas niedriger liegt. Auch innerhalb von Partnerschaften gibt es Diskrepanzen: In einem von drei Paaren, in denen Frauen im Alter bis 40 Jahre ein erstes Kind wollen, stimmen ihre Partner nicht damit überein. Frauen berücksichtigen bei der Nachwuchsplanung in einem größeren Ausmaß ihre eigene finanzielle Situation, ihre eigene Arbeit, die Wohnsituation und den Beruf des Partners.
Das Religionsbekenntnis bestimmt ebenfalls den Kinderwunsch. Bei der Frage nach der „idealen Kinderzahl“ geben im Schnitt Personen mit muslimischem Bekenntnis 2,6 an, Orthodoxe 2,5, praktizierende Katholiken 2,4, Katholiken ohne Kirchgang sowie Evangelische 2,1 und Personen ohne Bekenntnis 1,9. Die Realität schaut dann anders aus, so kommen Katholiken mit häufigem Kirchgang im Schnitt auf 1,8 Kinder.
Wie beim EU-Projekt ist auch das zentrale Anliegen der Österreich-Studie, Einflussfaktoren für bzw. gegen ein Kind darzulegen und Gründe für eine mögliche Diskrepanz zwischen der gewünschten Familiengröße und deren Umsetzung aufzuzeigen. Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass in Staaten mit höheren Leistungen für Familien der Kinderwunsch stärker ausgeprägt ist. Philipov teilt hier Europa in vier unterschiedliche Zonen nach Wohlfahrtsregimen („welfare regimes“): Erstens die Länder mit einem ausgeprägten Sozialsystem („sozialdemokratisches Wohlfahrtsregime“); das trifft auf die nordischen Staaten zu. Zweitens der Sonderfall Großbritannien als „liberales Wohlfahrtsregime“, in dem Marktmechanismen zentral sind und der Staat nur geringfügig interveniert. Drittens die mitteleuropäischen Länder wie Deutschland und Österreich („konservatives Wohlfahrtsregime“) und viertens die südeuropäischen Länder mit einer ausgeprägten familiären Struktur.
Der Unterschied zeige sich beispielsweise in der Stellung der Frauen in den nordischen Ländern, die Kind und Beruf gut vereinbaren können, und der Frauen in Österreich, die sich zu oft für ein Kind oder die berufliche Karriere entscheiden müssen. Dabei sind traditionelle Geschlechterrollen noch wirksam, nach denen der Mann für den hauptsächlichen Teil des Haushaltseinkommens zuständig ist, die Frau für die Betreuung der Kinder und meist für einen gewissen Zuverdienst. Eine Änderung dieser sozialen Normen ist aber nicht von heute auf morgen möglich, das sei eine Entwicklung von vielen Jahren, vielleicht sogar von einigen Jahrzehnten.
Die Regierungen können mit Maßnahmen helfen. „Herkömmliche Mittel wie Kindergeld und Elternurlaub unterstützen die Eltern, indem sie ihnen Zeit und Geld für die Kinderbetreuung zur Verfügung stellen“, sagt Philipov. Aus den Erhebungen geht aber hervor, dass soziale Normen und persönliche Einstellungen für die Fortpflanzung eine wichtigere Rolle spielen. Und wenn Leute keine Kinder haben wollen, dann können auch Gesetze und Unterstützungen nichts ausrichten.
In Österreich will ein Zehntel der Bevölkerung überhaupt kinderlos bleiben, ein weiteres Zehntel kommt übrigens unfreiwillig in diesen Status. 60 Prozent der jüngeren Frauen (18 bis 24 Jahre) wollen zwei Kinder, 23 Prozent drei oder mehr. Bei Männern liegen diese Werte bei 61 und 17 Prozent. In den Niederlanden realisierten 75 Prozent derer, die einen Kinderwunsch hatten, der sich innerhalb von drei Jahren erfüllen sollte, diesen, während die entsprechenden Anteile in der Schweiz bei 55 Prozent und in Ungarn bei 40 Prozent liegen. Wie hoch ist der Anteil in Österreich? Hierzulande wird nach der Studie von 2009 eine für 2012 geplante Erhebung mit denselben Befragten die Antwort geben. Dann wird man sehen, ob der für „jetzt“ oder „innerhalb von drei Jahren“ formulierte Kinderwunsch auch tatsächlich erfüllt wurde – wie weit also das Wollen von der Realität abweicht. Finanziell gesichert ist diese Erhebung freilich noch nicht. Estland hat die Folgestudie wegen Finanzmangels absagen müssen.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2011)
Quelle: http://diepresse.com/home/science/623761/Kinderwunsch-und-dann-die-Realitaet?from=gl.home_wissenschaft
04.01.2011
Der geplatzte Traum vom Kind
Osnabrück. Der Medizin-Nobelpreis für den Briten Robert Edwards hat in diesem Jahr die Erfolge der Reproduktionsmedizin in die Schlagzeilen gebracht. Doch es gibt weiterhin Paare, bei denen die Behandlung erfolglos bleibt und die darunter leiden.
Die Osnabrücker Beratungsstelle von Pro Familia startet deshalb im kommenden Jahr eine regelmäßige Telefonsprechstunde und eine neue Gruppe für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. „Für sie war die Berichterstattung zu diesem Nobelpreis besonders schmerzhaft“, sagt die Diplom-Psychologin Susanne Steinhübel. Denn sie haben erlebt, dass doch nicht alles machbar ist, dass auch die moderne Reproduktionsmedizin ihre Grenzen hat und sie dabei die Leidtragenden sind.
Tatsache sei aber, dass bei Weitem nicht jedes Paar mithilfe der Reproduktionstechnik ein Kind bekommen könne, betont Steinhübel. Mehr als die Hälfte aller Paare bleibt trotz intensiver Behandlung kinderlos. Wenn der Traum vom eigenen Kind nicht aber erfüllt wird, geraten viele der Paare in eine Lebenskrise, „die aber auch zusammenschweißen kann“, sagt Steinhübel.Wichtig sei es, die Energie auf eine Neuorientierung umzuschwenken und neue Perspektiven zu entwickeln.
Hilfe dabei soll eine neue Gruppe bieten, die im Februar beginnt. Schon am 4. Januar findet von 14.30 bis 15.30 Uhr die erste Telefonsprechstunde zu dem Thema statt. Susanne Steinhübel beantwortet alle Fragen rund um den Kinderwunsch, der nicht auf natürlichem Weg zu erfüllen ist.
Telefonsprechstunde : jeden ersten Dienstag im Monat, 14.30 bis 15.30 Uhr, unter 0541/23907
Quelle: http://www.noz.de/artikel/50401902/der-geplatzte-traum-vom-kind